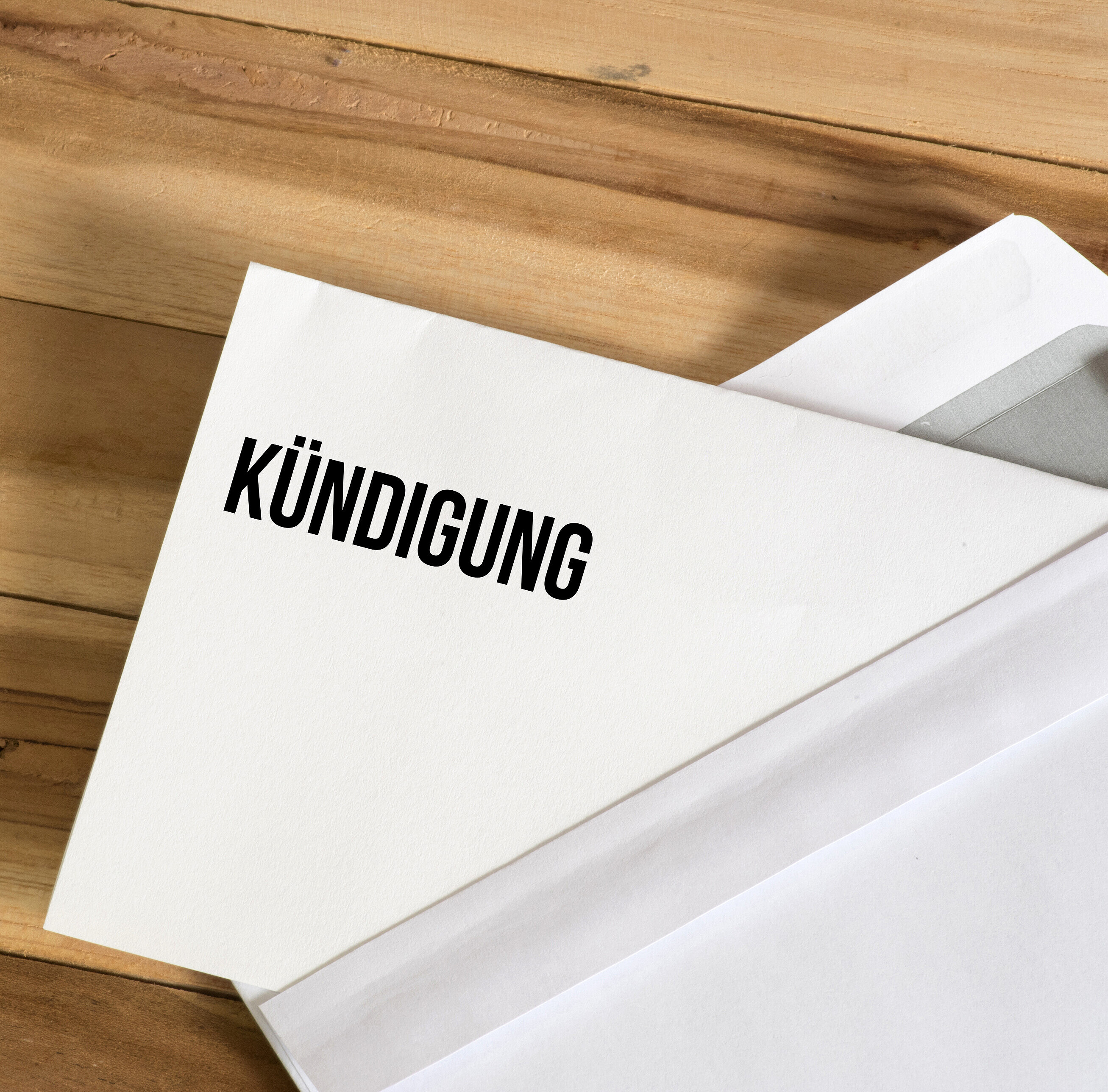Auftrag: Pflichten der Parteien im Auftragsverhältnis

Passende Arbeitshilfen
Pflichten des Beauftragten
Der Beauftragte ist verpflichtet, den Auftrag vertragsgemäss auszuführen (Art. 394 OR). Er schuldet also eine Tätigkeit, wobei der Auftraggeber den Beauftragten mit Instruktionen und Informationen unterstützen kann und sogar dazu verpflichtet ist. Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes. Der Beauftragte schuldet sorgfältige Erledigung der ihm anvertrauten Aufgaben, jedoch schuldet er kein bestimmtes Ergebnis oder Erfolg. Das unterscheidet den Auftrag vom Werkvertrag, bei dem das vereinbarte Ergebnis erreicht werden sollte und das auch möglich ist.
Beispiele
Auftrag: Eine Operation, da kann der Auftraggeber zwar erwarten, dass sie fachgerecht durchgeführt wird, aber nicht unbedingt, dass sie erfolgreich ist.
Werkvertrag: Ein Vertrag über einem Umbau, bei dem der Auftraggeber einen bestimmten Standard erwarten kann, den zu erreichen auch möglich ist.
Der Auftrag ermächtigt automatisch zu den Rechtshandlungen, die zu dessen Ausführung gehören. Eine besondere Vollmacht benötigt der Beauftragte, wenn es sich darum handelt, einen Vergleich abzuschliessen, ein Schiedsgericht anzunehmen, wechselrechtliche Verbindlichkeiten einzugehen, Grundstücke zu veräussern oder zu belasten oder Schenkungen zu machen (Art. 396 Abs. 2 und 3 OR).
Der Beauftragte ist in fremdem Interesse tätig. Er hat alles zu unternehmen, was dem Erreichen des Vertragszweckes dienlich ist und alle den Vertragszweck gefährdenden Handlungen zu unterlassen. Mit Vertragsabschluss erhält der Beauftragte die Verantwortung für die Ausführung des Auftrags.
Die Tätigkeit wird so lange geschuldet, bis der Auftrag beendet ist oder der Beauftragte von der Kündigungsmöglichkeit Gebrauch macht. Der Beauftragte macht sich schadenersatzpflichtig, wenn er nicht tätig wird. Falls er doch nach weiterer Überlegung den Auftrag nicht durchführen will, ist er verpflichtet, zu kündigen.
Sorgfaltspflicht des Beauftragten
Der Beauftragte haftet laut Art. 398 Abs. 1 für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnissen nach Art. 321 a und e OR: Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Der Arbeitnehmer haftet unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der Fachkenntnisse. Heute sind die Juristen allerdings der Meinung, dass die Haftung von Beauftragten strenger ist als die des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer untersteht einem Subordinationsverhältnis, der Beauftragte hingegen nicht. Er handelt als selbständige Person bzw. Fachmann.
Anmerkung
Ohnehin besteht die Tendenz, die Auftrags- und Beratungshaftung immer weiter auszudehnen und strenger zu interpretieren.
Der Beauftragte kann sich jedoch insbesondere nicht auf geringere Fachkenntnisse berufen. Der Beauftragte hat stets für diejenige Sorgfalt einzustehen, ‹welche ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt›. Er muss also die für die Berufsgruppe des jeweiligen Beauftragten durchschnittlichen Fähigkeiten besitzen. Hat er sie nicht, sollte er das so genannte Übernahmeverschulden vermeiden, indem er den Auftrag gar nicht annimmt.
Persönliche Erfüllung
Der Beauftragte hat grundsätzlich den Auftrag persönlich zu erfüllen. Der Einsatz von Angestellten, die unter Aufsicht und Anleitung des Beauftragten arbeiten, ist möglich. In vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass das üblich ist (OR Art. 398). Jedenfalls haftet dann der Beauftragte für die Handlungen seiner Mitarbeitenden wie für seine eigenen. In diesen Fällen ist je nach Umständen die Geschäftsherrenhaftung nach OR Art. 55 oder die Haftung für Hilfspersonen nach OR Art. 101 zu berücksichtigen.
Zu unterscheiden ist zwischen Einsatz von Hilfspersonen und Substitution. Letzteres bedeutet die Übertragung des Auftrages oder Teilen davon an einen Dritten, der die Aufgabe selbständig erledigt. Dies ist dann möglich, wenn Vertretung üblicherweise als zulässig erachtet wird oder durch die Umstände gerechtfertigt ist, z.B. weil der Beauftragte bestimmte Fachkenntnisse nicht besitzt. Keine persönliche Tätigkeitspflicht hat der Beauftragte dann, wenn er vom Auftraggeber zur Übertragung des Auftrags an einen Dritten ermächtigt wird. Die Befugnis, einen Substituten beizuziehen, hat im Prinzip der Beauftragte zu beweisen.
Wichtig: Hat der Beauftragte den Auftrag unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären (Art. 399 Abs. 1).
Der Auftraggeber kann ein Interesse daran haben, die Kenntnis seiner Angelegenheit auf einen bestimmten, von ihm ausgewählten Personenkreis zu beschränken. Dann schliesst die richtige Erfüllung durch den Substituten eine Haftung des Beauftragten nicht aus. Die Vertragsverletzung, die der Beauftragte durch eine unbefugte Vergabe des Auftrags an einen Dritten begeht, kann zu einer Schadenersatzpflicht führen.
Treuepflicht
Die Treuepflicht gehört zu den Wesensmerkmalen des Auftrages. Sie besteht darin, die Interessen des Auftraggebers so gut wie möglich zu wahren und alles zu unterlassen, was diese beeinträchtigen könnte. Weiter muss der Beauftragte die Interessen des Auftraggebers bei Interessenkonflikten wahren. Das heisst, er muss unter Umständen andere Aufträge ablehnen.
Beispiel: Ein Anwalt kann nicht gleichzeitig zwei Prozessgegner beraten, es sei denn er würde sich offen als Mediator betätigen.
Zur Treuepflicht gehört auch die vertragsgemässe Verwendung und sorgfältige Verwahrung der zur Durchführung des Auftrags überlassenen Gegenstände und Mittel.
Aus der Treueverpflichtung folgen weitere Verpflichtungen, nämlich die Geheimhaltungspflicht, die Benachrichtigungs- und Informationspflicht, die Weisungsbefolgungspflicht, die Rechenschaftspflicht sowie die Erstattungspflicht.
Zur Treuepflicht gehört auch, dass man nicht Angestellte des Auftraggebers abwirbt oder Personen zum Vertragsbruch verleitet, um selber mit ihnen eine Vertrag abzuschliessen, was auch nach Art. 4 UWG verboten ist. Generell sind unlautere Geschäftsmethoden zu unterlassen.
Geheimhaltungspflicht
Die Geheimhaltungspflicht verpflichtet den Beauftragten, Informationen und Daten, die er vom Auftraggeber in irgendeiner Form erhält, geheim zu halten, ausser, wenn die Erfüllung des Auftrags die Information Dritter verlangt. Geheimzuhalten sind alle technischen und wirtschaftlichen und persönlichen Informationen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag stehen. Dabei ist es gleich, ob solche Informationen unmittelbar von der Vertragspartei oder von Dritten stammen. Die Informationen dürfen weder mündlich, schriftlich, noch in Form von Zeichnungen, Muster oder IT-Daten an Dritte weitergegeben werden. Die Parteien haben auch dafür zu sorgen, dass Angestellte die Daten geheim halten und die Grundsätze der Datensicherung befolgen. Für bestimmte Aufträge ist die Geheimhaltungspflicht speziell gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn man für die Erfüllung des Auftrages Drittpersonen hinzuzieht, gilt die Geheimhaltungsverpflichtung auch für diese.
Passende Produkt-Empfehlungen
Bei schriftlichen Verträgen ist eine Geheimhaltungsklausel zu empfehlen, nach welcher der Beauftragte Dritte zu ebenso strenger Geheimhaltung verpflichten muss.
Besonders wenn der Vertrag mit Geschäftsgeheimnissen verbunden ist, kann ein Abwerbeverbot nützlich sein.
Wichtig ist, dass die Geheimhaltungsverpflichtung auch nach Erledigung vom Auftrag oder nach vorzeitiger Beendigung des Auftragsverhältnisses gilt. Sie ist sogar dann zu beachten, wenn der Auftraggeber Informationen geliefert hat und es gar nicht zu einem Auftragsverhältnis gekommen ist.
Zur Geheimhaltungsverpflichtung gehört, dass das Datenschutzgesetz (DSG) und die Datenschutzverordnung zu beachten sind. Im Prinzip ist der Inhaber einer Datensammlung für den gesetzeskonformen Umgang mit diesen Daten verantwortlich, gleichgültig, wer die Daten bearbeitet. Natürlich hat der Beauftragte auch für Datensicherheit zu sorgen. Die Verordnung zum Datenschutzgesetz fordert Massnahmen, die dem Stand der Technik entsprechen. Dem Auftraggeber ist zu empfehlen, dass er jederzeit die Kontrolle über seine Daten behält.
Benachrichtigungs-, Informations- und Rechenschaftspflicht
Gegenüber dem Auftraggeber hat der Beauftragte eine Informationspflicht. Der Beauftragte schuldet dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über seine Geschäftsführung, namentlich Informationen über den Stand der Dinge (Art. 400 OR). Dazu gehören schriftliche Aufzeichnungen über seine Tätigkeit und Dokumentationen über die Entwicklung des Projekts, sowie das Archivieren von Korrespondenz usw.
Der Beauftragte muss dem Auftraggeber sämtliche Tatsachen, Vor- und Nachteile in Bezug auf den auszuführenden Auftrag offen legen. Die Information hat vollständig, wahrheitsgemäss und rechtzeitig zu erfolgen. So muss sich der Beauftragte vergewissern, dass die Mitteilung dem Auftraggeber innert nützlicher Frist zugeht.
Bei grösseren Aufträgen ist zu empfehlen, dass man schriftlich vereinbart, wie oft und in welcher Form der Beauftragte den Auftraggeber über den Stand der Angelegenheiten zu informieren hat. Wenn nötig hat der Beauftragte den Auftraggeber auch ausserhalb des vereinbarten Rhythmus über Neuigkeiten oder Probleme zu informieren.
Sinnvoll ist bei grösseren Aufträgen auch, bestimmte Pflichten für den Auftraggeber festzulegen, womit er zur Verhinderung eines Schadens beitragen muss, z.B., dass der Kunde bestimmte Kontaktpersonen informieren muss, wenn sich Pannen ergeben.
Rechenschaft abzulegen liegt auch im Interesse des Beauftragten, der sich auf diese Weise vergewissern kann, dass er weiterhin das Vertrauen des Auftraggebers geniesst und mit der Rechenschaftsablegung den Nachweis für das Tätigsein erbringt. Die Rechenschaftspflicht ist eine Vorschrift zwingenden Rechts und ist selbständig einklagbar.
Instruktionen des Auftraggebers
Hat der Auftraggeber für die Besorgung des übertragenen Geschäftes eine Vorschrift gegeben, so darf der Beauftragte nur insofern davon abweichen, als nach den Umständen die Einholung einer Erlaubnis nicht tunlich und überdies anzunehmen ist, der Auftraggeber würde sie bei Kenntnis der Sachlage erteilt haben. Ist der Beauftragte, ohne dass diese Voraussetzungen zutreffen, zum Nachteil des Auftraggebers von dessen Vorschriften abgewichen, so gilt der Auftrag nur dann als erfüllt, wenn der Beauftragte für diesen haftet (Art. 397 OR).
Die Weisungsbefolgungspflicht bezieht sich auf die Bedürfnisse und Wünsche des Auftraggebers, auch wenn sich diese nach der Auftragserteilung ändern. Der Beauftragte nimmt die jeweils aktuellen Interessen des Auftraggebers wahr, indem er das übertragene Geschäft sorgfältig und getreu ausführt und die Weisungen des Auftraggebers befolgt.
Sind die Instruktionen für die Auftragserfüllung oder für ihn selber schädlich oder unzweckmässig, ist der Beauftragte verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen. Die Weisungsbefugnis des Auftraggebers besteht nur innerhalb des vereinbarten Vertragsgegenstandes.
Wichtig: Wenn ein Auftraggeber zur Wahrung seiner Interessen einen Beauftragten beizieht, ändert sich nichts an seinem Recht, in den eigenen Angelegenheiten nach Belieben zu verfahren. Es ist aber in beiderseitigem Interesse notwendig, dass der Auftraggeber den Beauftragen rechtzeitig darüber informiert, noch besser eigenes Vorgehen mit ihm vereinbart.
Rückgabepflicht
Das Gesetz bestimmt, dass der Beauftragte verpflichtet ist, alles, was ihm infolge des Auftrags aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, jederzeit zurückzugeben.
Das gilt auch für Unterlagen, Daten, Gegenstände usw., die er von Dritten im Rahmen der Durchführung des Auftrags erhalten hat. Beim Tod des Auftraggebers besteht die Rückgabepflicht auch gegenüber den Erben oder Rechtsnachfolgern.
- Arbeits- oder Hilfsmittel (Notizen, Skizzen, Berechnungen, Dokumentationen etc.), die der Beauftragte selbst angefertigt hat, um den Auftrag oder seine Auskunftspflicht zu erfüllen, müssen nicht zurückgegeben werden.
- Wenn es sich um Datensammlungen handelt, ist eine schriftliche Vereinbarung zu empfehlen, sodass beide Parteien das Eigentum und alle Rechte an den Daten bzw. den Datensammlungen sowie Programmen, Unterlagen und Codes, die von einer Vertragspartei der anderen überlassen wurden, sollen nach Beendigung oder vorzeitigem Abbruch des Projekts der Vertragspartei zurückgegeben werden, die sie zur Verfügung gestellt hat.
- Der anderen Partei überlassene Unterlagen und Daten sollten nur zum eigenen Gebrauch kopiert werden. Die Kopien müssen nach Beendigung der Geschäftsbeziehung völlig vernichtet werden. Elektronische Datensätze sind so zu löschen, dass sie nicht rekonstruierbar sind.
- Das gilt auch, wenn das Auftragsverhältnis vorzeitig abgebrochen wird oder es gar nicht zu einem Auftrag kommt.
- Zu beachten ist, dass der Auftrag erst als beendet gilt, wenn die Rückgabepflicht erfüllt ist. Der Auftraggeber kann also nicht mit der Rückgabe warten, bis das Honorar bezahlt ist. Im Gegenteil, das Honorar wird erst geschuldet, wenn die Rückgabepflicht erfüllt ist, es sei denn, es wäre etwas anderes verabredet.
Zahlung einer Vergütung
Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Art. 394 Abs. 3 OR). Mit Vorteil vereinbart man ein Honorar vor Vertragsabschluss oder zumindest die Kriterien, nach denen es berechnet wird, z.B. Stundenansatz, Prozente usw. Bei grösseren Aufträgen ist eine schriftliche Abmachung zu empfehlen. Sonst gelten folgende Regeln:
Haben die Parteien nichts vereinbart, so wird eine Vergütung dann geschuldet, wenn sie für die Leistung üblich ist. Das gilt besonders, wenn der Beauftragte die Dienstleistung beruflich anbietet. Dann ist davon auszugehen, dass ein Honorar geschuldet wird.
Steht die Entgeltlichkeit des Auftrages fest, so sind die Form und die Höhe der Vergütung zu bestimmen. Das bereitet oft Schwierigkeiten. Das Honorar lässt sich auf verschiedene Art festsetzen, z.B. Pauschalsumme, in Prozent vom Wert des besorgten Geschäfts, für Zeitaufwand. Zudem lassen sich diese Methoden kombinieren. Das Erfolgshonorar ist im Prinzip erlaubt, kann aber als standeswidrig gelten.
Häufig wird bei der Festsetzung des Honorars auf Tarife verwiesen, die von Verbänden festgelegt sind. Diese entsprechen aber nicht immer dem, was üblich ist. Das Publikum muss nur Tarife akzeptieren, die bekannt sind oder die man leicht eruieren kann.
Wird ein Honorar nicht bei Vertragsabschluss festgesetzt, sind die besonderen Umstände zu berücksichtigen, wie Zeitaufwand und Art der Dienstleistung.
Wenn der Beauftragte den Auftrag nicht vertragsgemäss ausgeführt hat kann der Auftraggeber das Honorar reduzieren.
Auslagen- und Spesenersatz
Art. 402 Abs. 1 OR verpflichtet den Auftraggeber zum Ersatz der Auslagen und Spesen des Beauftragten, soweit diese für sorgfältige Ausführung des Auftrages nach den Instruktionen des Beauftragten notwendig sind. Als Auslagen und Verwendungen gelten Vermögenseinbussen des Beauftragten. Die Terminologie ist entsprechend vielfältig: Auslagen, Kosten, Unkosten, Spesen, Verwendungen, Aufwendungen usw.
Der Beauftragte hat Anspruch auf Befreiung von den eingegangenen Verbindlichkeiten (Art. 402 Abs. 1 OR). Übernimmt der Beauftragte gegenüber einem Dritten Verpflichtungen in eigenem Namen, aber auf Rechnung des Auftraggebers, so vermindert er zwar nicht seine Aktiven, erhöht aber seine Passiven. Die Lage ist grundsätzlich dieselbe wie bei bereits geleisteten Auslagen. Der Befreiungsanspruch ist deshalb unter den gleichen Voraussetzungen zu gewähren. Das bedeutet, der Auftraggeber hat die für die sorgfältige Ausführung seines Auftrags aufgewendeten Kosten vollumfänglich zu übernehmen.
Schäden, die der Beauftragte bei der Ausführung des Auftrags erlitten hat, muss der Auftraggeber ersetzen. Die Ersatzpflicht für den Auftraggeber entsteht und wird fällig mit der Vermögensminderung auf Seiten des Beauftragten (Art. 402 Abs. 2 OR). Die Haftung des Auftraggebers setzt einen dem Beauftragten zugefügten Schaden voraus, der vom Auftraggeber verschuldet ist. Dazu muss ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden bestehen. Dabei wird das allgemeine Schadenersatzrecht angewendet. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Auftraggeber dem Beauftragten wichtige, für die Ausführung des Auftrags notwendige Unterlagen oder Informationen vorenthalten hat und dieses Verhalten dem Beauftragten Schaden zugefügt hat.
Zu beachten ist, dass die Haftung des Auftraggebers immer strenger wird. An den Exkulpationsbeweis des Auftraggebers werden hohe Anforderungen gestellt. Vor allem bei unentgeltlichen Aufträgen muss der Auftraggeber auch unverschuldeten Schaden ersetzen, soweit dies nach Ermessen des Richters billig ist. Bei entgeltlichen Aufträgen an Berufspersonen entspricht die Risikoverteilung den normalen Anforderungen im Geschäftsleben.
Haben mehrere Personen gemeinsam einen Auftrag gegeben, so haften sie dem Beauftragten solidarisch. Haben mehrere Personen einen Auftrag gemeinschaftlich übernommen, gilt ebenfalls die Solidarhaftung. Soweit sie nicht zur Übertragung der Besorgung an einen Dritten ermächtigt sind, müssen die Beauftragten gemeinsam handeln (Art. 403 OR).
Beendigung des Auftrages
Nach 404 Abs. 1 OR kann der Auftrag von jeder Partei immer widerrufen oder gekündigt werden. Diese Möglichkeit kann laut Bundesgericht nicht vertraglich aufgehoben werden, man kann auch keine Konventionalstrafe vereinbaren. Den Widerruf muss man nicht begründen. Man kann natürlich trotzdem eine Kündigungsfrist vereinbaren, die aber das Recht zum jederzeitigen Widerruf nicht aufheben darf, was entsprechend zu formulieren ist.
Wichtig: Es ist sehr zu empfehlen, eine Vergütungspflicht für die bereits erbrachten Leistungen zu vereinbaren für den Fall, dass eine Partei das Auftragsverhältnis auflöst. Im Gesetz gibt es darüber keine Regelung.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt die Annahme eines unzeitigen Widerrufs voraus, dass der Beauftragte dazu keinen begründeten Anlass gegeben hat und die Vertragsauflösung für den Beauftragten hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. Hingegen gilt eine Auftragskündigung aus einem der Risikosphäre der zurücktretenden Partei zuzuordnenden Grund, z.B. gesundheitliche Probleme, nicht als Rechtfertigung für eine Kündigung zu Unzeit. Prinzipiell wird gefordert, dass die nicht zurücktretende Partei der anderen Partei einen Anlass für deren Rücktritt setzt (Bundesgerichtsurteil 4A_275/2019 vom 29. August 2019).
Damit ein Schadenersatzanspruch besteht dürfen keine ernsthaften Gründe für die Kündigung vorliegen und für die Schadenersatz beanspruchenden Partei muss aufgrund von Dispositionen, die sie zur Erfüllung des Auftrags getroffen hat, ein Schaden entstanden sein. Es gilt nicht als Kündigung des Auftrags zur Unzeit, wenn der Beauftragte dem Auftraggeber begründeten Anlass zur Auftragsauflösung gegeben hat (4A_436/2021 Urteil vom 22. März 2022).
Kündigung zur Unzeit besteht nach Bundesgericht auch, wenn der Auftraggeber den Vertrag in einem Zeitpunkt auflöst, in dem sämtliche Vorbereitungen für den erfolgreichen Abschluss einer Transaktion (z.B. eines Inkassos) geleistet sind, die den Beauftragten zu einem Honorar berechtigt, und nur noch der Abschluss der Transaktion selbst aussteht. Das interpretiert das Bundesgericht regelmässig als treuwidriges Verhalten des Auftraggebers mit dem Zweck, den Honoraranspruch zu vereiteln. Wird die honorarbegründende Transaktion in diesem Fall nach Vertragsbeendigung abgeschlossen, ist der Beauftragte so zu stellen, wie wenn dies noch während der Vertragsdauer geschehen wäre (BGE 4A_523/2018 vom 6. Dezember 2018).
Wenn der Widerruf oder die Kündigung zur Unzeit erfolgt haftet nach Art. 404 Abs. 2 OR der Zurücktretende dem anderen für den verursachten Schaden. Als besondere Nachteile gelten nicht die normalen Folgen eines Widerrufs, z.B. dass dem Beauftragten ein Teil des Honorars entgeht oder der Auftraggeber einen neuen Beauftragten finden muss. Nach Bundesgericht ist grundsätzlich ist das negative Interesse zu ersetzen, z.B. für nutzlos gewordene Aufwendungen oder für Gewinn, auf den der Beauftragte verzichtet hat, um sich dem Auftrag zu widmen. Der Beauftragte muss seine Kosten, z.B. für Personal und Material, ausreichend nachweisen. Eine Konventionalstrafe ist nur insoweit gültig, als sie nicht den Rahmen übersteigt, der gemäss Art. 404 Abs. 2 OR Voraussetzung der Schadenersatzpflicht bildet (Urteil 4A_196/2020 vom 16. Juli 2020).
Wichtig: Wird der Auftrag durch Übereinkunft aufgehoben, so entfällt die Ersatzpflicht. Man kann dann davon ausgehen, dass kein Widerruf zur Unzeit besteht.
Nach OR Art. 405 erlischt der Auftrag bei Tod, Handlungsunfähigkeit oder Konkurs des Beauftragten, sofern nicht das Gegenteil vereinbart oder aus der Natur des Geschäftes zu folgern ist. Nach OR Art. 406 wirken die gesetzlichen Beendigungsgründe erst, wenn der Auftraggeber davon erfährt. Bis dahin ist der Auftraggeber bzw. sein Rechtsnachfolger so verpflichtet wie wenn der Auftrag noch bestanden hätte.
Wichtig: Bei individuellen Aufträgen, vor allem wenn diese umfangreich sind oder unbefristet, sollte man für solche Fälle im Vertrag auf mögliche ausserordentliche Kündigungsgründe hinweisen, aber ohne das jederzeitige Kündigungsrecht einzuschränken.
Formulierungsbeispiel:
Wenn die Weiterführung dieses Vertrages für eine Partei aus wichtigen Gründen unzumutbar wird, kann diese den Vertrag jederzeit (ausserordentlich) auflösen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere:
der Tod bzw. der Konkurs des Klienten
höhere Gewalt (wie Naturgewalten oder Krieg)
eine massive Vertragsverletzung durch die andere Partei, die zur Folge hat, dass die Fortführung des Vertrags unzumutbar ist
strafrechtliche Untersuchungen gegen eine der Parteien
Entzug der erforderlichen Bewilligungen für den Beauftragten