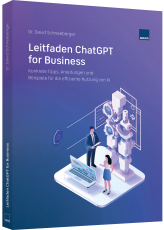Dienstleistungsvertrag: Missverständnisse bei Dienstleistungsverträgen

Passende Arbeitshilfen
Einleitung Dienstleistungsvertrag
Innominatkontrakte
Die vielfältigen Erscheinungsformen von Dienstleistungsverträgen im Rechtsalltag sind nur zum Teil gesetzlich geregelt, mehrheitlich im Obligationenrecht, aber auch in Spezialgesetzen (z.B. Arbeitsvermittlungsvertrag, Pauschalreisenvertrag). Für andere Dienstleistungsverträge («Innominatkontrakte») haben sich aussergesetzliche Regeln entwickelt, wie etwa für den Franchising- oder den Alleinvertriebsvertrag, oder sie tauchen als Mischformen verschiedener Verträge auf (z.B. die Kommissionsagentur als Mischung aus Kommission und Agenturvertrag).
Die Qualifikation eines bestimmten Vertrags, d.h. dessen Zuordnung zu gesetzlichen oder ungeschriebenen Rechtsregeln, bereitet im Geschäftsalltag gelegentlich Schwierigkeiten und ist auch für den Fachmann oftmals anspruchsvoll, zumal in einigen Abgrenzungsfragen unterschiedliche Lehrmeinungen vorliegen und auch nicht überall eine einheitliche Rechtsprechung besteht.
Vorliegend wird das Wesen der Dienstleistungsverträge mit Fokus auf deren Einordnung im Rechtssystem und deren Abgrenzung untereinander beleuchtet, als Orientierungshilfe für praktische Fragen wie:
- Wann ist ein vermeintlich freier Mitarbeiter im Auftragsverhältnis tatsächlich ein Arbeitnehmer, der die Schutzbestimmungen des Arbeitsrechts in Anspruch nehmen kann und für den der Arbeitgeber Sozialversicherungen zahlen muss?
- Oder: Wann ist ein vermeintlicher Agenturvertrag tatsächlich ein Alleinvertriebsvertrag?
Ist eine Dienstleistung entgeltlich oder eine Gefälligkeit?
Steht der Dienstleister in einem Unterordnungsverhältnis zum Dienstleistungsempfänger?
Handelt es sich um einen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit abgeschlossenen Dauervertrag oder um einen einmaligen Vertrag, dessen Erfüllung zwar auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, sich aber grundsätzlich in der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung erschöpft?
Liegt ein Auftrag oder ein Werkvertrag vor? Schuldet der Dienstleister dem Dienstleistungsempfänger ein bestimmtes Resultat, ein Ergebnis, oder lediglich ein Tätigwerden nach anwendbaren Sorgfaltspflichten und bestem Wissen und Gewissen?
Kern der Dienstleistungsverträge ist, dass der Dienstleister dem Kunden, bzw. Dienstleistungsempfänger einen Service erweist, der für ihn einen materiellen oder ideellen Vorteil enthält, der häufig keine Sachleistung ist, z.B. die Behandlung des Arztes, Prozessvertretung des Anwalts, Maschinenentwicklung des Ingenieurs, Konzertdarbietungen. Die Arten von Dienstleistungen sind äusserst zahlreich, mit zunehmender Tendenz, entsprechend der Entwicklung hin zur Dienstleistungsgesellschaft mit zunehmender Bedeutung des tertiären Wirtschaftssektors. Laufend neue Dienstleistungsbereiche entstehen im Zuge der Entwicklung von Internet und Kommunikationstechnik, die ihrer rechtlichen Erfassung regelmässig vorauseilen.
Die Rechtsverhältnisse bei Dienstleistungen basieren i.d.R. auf vertraglicher Absprache der Parteien, aber nicht immer (nicht bei der Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419 ff. OR). Sie enthalten zudem meistens eine Pflicht des Dienstleisters zur Erbringung der Dienstleistung, Ausnahmen sind (z.B. bei Gefälligkeitsabreden und auslobungsähnlichen Tatbeständen). Unter den verbleibenden eigentlichen Dienstleistungsverträgen lässt sich sodann eine Grobeinteilung nach dem Kriterium der Entgeltlichkeit vornehmen: Dienstleistungen sind im kommerziellen Bereich i.d.R. entgeltlich, unentgeltliche Dienstleistungen stehen eher den Gefälligkeitsabreden nahe.
121 III 336 Bundesgerichtsurteil vom 4. August 1995
Was ist ein Konsumentenvertrag?
Der Verbraucher- oder Konsumentenvertrag lässt sich nicht ohne weiteres in das übliche Schema der Vertragsarten eingliedern. Entscheidend ist nach der gesetzlichen Definition, dass der Vertrag zwischen einem Anbieter und einem Verbraucher (Konsument) geschlossen wird und die vertragliche Sache oder Leistung für dessen privaten Bedarf bestimmt ist. Konsument ist daher, wer Waren oder Dienstleistungen für den privaten, persönlichen Verbrauch empfängt oder beansprucht - er gilt als Letztverbraucher. Der Verbrauchervertrag hat Leistungen zum Gegenstand, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht in Zusammenhang mit seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit stehen. Der Begriff des Konsumentenvertrags kann damit sämtliche obligationenrechtlichen Verträge umfassen, sofern die Vertragsparteien Anbieter und Konsumenten sind. Das spielt bei internationalen Verträgen eine Rolle bei der Bestimmung des Gerichtsstandes, siehe unten.
In der Literatur werden folgende Dienstleistungsverträge aufgezählt: Pauschalreisen, Schlankheitskuren, Reparaturen, Kleiderreinigungen, Fernkurse, Heiratsvermittlungen, Verträge über Hotelunterkunft sowie über Lehrveranstaltungen z.B. Sprach-, Ski- oder Segelkurse. Hingegen werden solche Rechtsgeschäfte vom Begriff des Konsumentenvertrags ausgenommen, bei welchen nicht der kommerzielle Charakter, sondern die persönlichen Beziehungen, insbesondere das Treueverhältnis zwischen den Parteien, im Vordergrund stehen.
Zusammenfassend ist laut Bundesgericht festzuhalten, dass es bei der Beurteilung eines Dienstleistungsvertrag im Hinblick auf dessen Qualifizierung als Konsumenten- oder Verbrauchervertrag nicht darauf ankommen kann, um welche Art von Vertrag es sich handelt, unter Vorbehalt der von der Schutzbestimmung ausdrücklich ausgenommenen Verträge. Belanglos ist auch die Struktur des Schuldverhältnisses, ob es sich um ein einfaches Schuldverhältnis, ein Dauerschuldverhältnis, einen Sukzessivlieferungsvertrag oder einen anderen Vertragstyp handelt. Entscheidend ist einerseits vielmehr, für welche Zwecke die fraglichen Verträge abgeschlossen werden, ob zu privaten oder beruflichen Zwecken. Anderseits ist die Rollenverteilung zwischen den Vertragsparteien massgebend. Anbieter ist, wer die charakteristische Leistung zu erbringen hat, Konsument oder Verbraucher dagegen, wer Waren oder Dienstleistungen für private Zwecke gebraucht oder beansprucht.
Passende Produkt-Empfehlungen
Auftrag oder Werkvertrag?
Wichtig ist wie oben erwähnt, auch die Frage, ob es sich bei einem bestimmten Dienstleistungsvertrag um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag handelt: Diese unterscheiden sich dadurch, dass beim Werkvertrag ein bestimmtes erreichbares Ergebnis geschuldet ist, z.B. ein Bauwerk. Beim Auftrag hingegen genügt fachgerechte Erfüllung nach aktuellem Wissensstand, und zwar weil man das gewünschte Ergebnis nicht garantieren kann, z.B. bei ärztlicher Behandlung.
Diese Unterscheidung ist enorm wichtig z.B. in Bezug auf die Möglichkeit, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden, was beim einfachen Auftrag nach Bundesgericht zwingend ist - mit Ausnahmen, beim Werkvertrag hingegen im Prinzip nicht.
Die Liste solcher Abgrenzungsfragen mit wichtigen Konsequenzen rechtlicher Art liesse sich fast beliebig verlängern, was den vorliegenden Rahmen sprengen würde. Den mit Dienstleistungsverträgen im Geschäfts- oder Privatleben Betroffenen sei empfohlen, den Vertrag nach erwähnten Kriterien richtig zuzuordnen und sich über die gesetzlichen oder Standesregeln zu informieren, die den Rahmen und Spielraum für betreffende Vertragsverhandlungen vorgeben.
Achtung Unterordnungsverhältnis!
Ein Unterordnungsverhältnis ist Vertragsmerkmal bei allen Arten des Arbeitsvertrages, bei allen anderen OR Dienstleistungsverträgen nicht. Die Arbeitsverträge sind zudem Dauerschuldverhältnisse, ebenso der Agenturvertrag und die Hinterlegungsverträge. Alle anderen OR-Dienstleistungsverträge sind einfache, bzw. einmalige Verträge.
Viele scheinbar im Auftragsverhältnis tätige und jederzeit kündbare freie Mitarbeiter sind von Rechts wegen Arbeitnehmer nach Einzelarbeitsvertragsrecht – und zwar dann, wenn sie zum Dienstleistungsempfänger in einem Unterordnungsverhältnis stehen. Ein solches liegt vor, wenn der Dienstpflichtige nach dem Inhalt des Vertrags einer umfassenden Weisungsbefugnis des Vertragspartners untersteht, hinsichtlich der zu verrichtenden Arbeit, und auch in zeitlicher, örtlicher und organisatorischer Hinsicht. Dieser Dienstleistungsvertrag ist nur noch nach den arbeitsvertraglichen Regeln kündbar, und das Arbeitsverhältnis wird für die Sozialversicherungen abrechnungspflichtig, was schon manchem vermeintlichen Auftraggeber böse bzw. teure Überraschungen beschert hat.
Internationales Recht
Sobald ein Dienstleistungsverhältnis grenzüberschreitend ist, stellt sich zusätzlich – und vorab – die Frage, welches Recht anwendbar ist, bzw. wie weit man dies im Vertrag vereinbaren kann. Die obigen Ausführungen gelten für rein innerschweizerische Verhältnisse.
Ist der Dienstleister oder der Dienstleistungsempfänger im Ausland ansässig, oder ist die Dienstleistung im Ausland zu erbringen, muss geprüft werden, welches Landesrecht im konkreten Fall anwendbar ist.
Nach Art. 120 IPRG gilt folgendes für Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, siehe oben, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen: Diese unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn der Anbieter die Bestellung in diesem Staat entgegengenommen hat, wenn in diesem Staat dem Vertragsabschluss ein Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und der Konsument in diesem Staat die zum Vertragsabschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat oder wenn der Anbieter den Konsumenten veranlasst hat, sich ins Ausland zu begeben und seine Bestellung dort abzugeben. Eine Rechtswahl ist ausgeschlossen.
In der EU sind die Dienstleistungsrichtlinie und die auf ihr basierenden Gesetze zu beachten.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33237
Wichtig: Für grenzüberschreitende und generell internationale Dienstleistungsverhältnisse ist eine fachmännische Beratung zu empfehlen.
Das Praxisbeispiel: BGE 4C.252/2006 /len Urteil vom 21. November 2006
In diesem Urteil geht es um einen Dienstleister, der während des Dienstleistungsverhältnisses Wohnsitz im Ausland hatte. Das Bezirksgericht erachtete den Gerichtsstand am Erfüllungsort nach Art. 5 Ziff. 1 LugÜ (Lugano Übereinkommen) für gegeben, wobei es den Erfüllungsort in Anwendung von Art. 117 IPRG nach schweizerischem Recht bestimmte, da der Beklagte bei Abschluss des Vertrages Wohnsitz in Zürich gehabt hatte und der nachmalige Wegzug nicht zu einem Statutenwechsel geführt habe.
Der Diensleister anerkannte, dass er bei Vertragsschluss als Rechtsanwalt in Zürich tätig gewesen war. In diesem Zeitpunkt unterstand ein Vertragsverhältnis nach Art. 117 Abs. 2 IPRG, also grundsätzlich schweizerischem Recht. Der Dienstleister ging aber davon aus, es bestehe ein Dauerschuldverhältnis, da er unter anderem während mehrerer Jahre auch Verwaltungsrat der vom Vater der Kläger gegründeten Gesellschaft gewesen sei. Da die vertragliche Beziehung nach seinem Wegzug nach Spanien angedauert habe, sei von einem Wechsel des geltenden Rechts auszugehen. Berechtigte Erwartungen der Vertragspartner würden dadurch nicht gefährdet, da der Vertrag keinerlei Beziehung mehr zur Schweiz aufweise, nachdem keine der beteiligten Parteien mehr Wohnsitz in der Schweiz habe und der Sitz der Gesellschaft in Liechtenstein sei.
Nach Art. 117 IPRG, so das Bundesgericht, untersteht ein Vertrag bei Fehlen einer Rechtswahl dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt, wobei vermutet wird, der engste Zusammenhang bestehe mit jenem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Aufenthaltsortes gilt dabei grundsätzlich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Nur ausnahmsweise kann namentlich bei Dauerschuldverhältnissen die Änderung des Aufenthaltes des Erbringers der charakteristischen Leistung einen Rechtswechsel bewirken.
Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, den für die Beurteilung der Anknüpfungstatsachen massgeblichen Zeitpunkt festzulegen. Zu berücksichtigen sind vielmehr die gesamten Umstände des Einzelfalles. Bei der Zuweisung des Vertrages nach der charakteristischen Leistung handelt es sich lediglich um eine "Vermutung", so dass im Einzelfall zu prüfen bleibt, ob das Vertragsverhältnis zu einem anderen Recht ein engeres Verhältnis hat.
Eine Änderung des geltenden Rechts rechtfertigt laut Bundesgericht nur, wenn sich während der Vertragsdauer ein derart enger Zusammenhang mit einer anderen Rechtsordnung ergibt, dass dieser besonderes Gewicht zukommt.
In Bezug auf einen Wohnsitzwechsel ist davon auszugehen, ob das Vertragsverhältnis funktionell darauf ausgerichtet ist, dass der Erbringer der charakteristischen Leistung die einmal vereinbarte Leistung weiterhin unverändert erbringt, unabhängig davon, wo er sich aufhält, oder ob die Leistung beziehungsweise das Vertragsverhältnis derartige Verbindungen zu seinem neuen Wohnsitz aufweist, dass die Unterstellung unter das bei Vertragsabschluss geltende Recht den vertraglichen Beziehungen funktionell nicht mehr gerecht wird.
In diesem Fall entschied das Bundesgericht: Die Vorinstanz ging zu Recht davon aus, dass mit dem Wohnsitzwechsel keine Schwerpunktverlagerung des Vertragsverhältnisses einherging. Der Vertrag war vielmehr funktionell auf die gleichbleibende Weiterführung des Mandats ausgerichtet. Damit besteht der engste Zusammenhang nach wie vor mit dem Recht, nach welchem sich die vertraglichen Rechte und Pflichten bei Abschluss des Vertrages bestimmt haben.