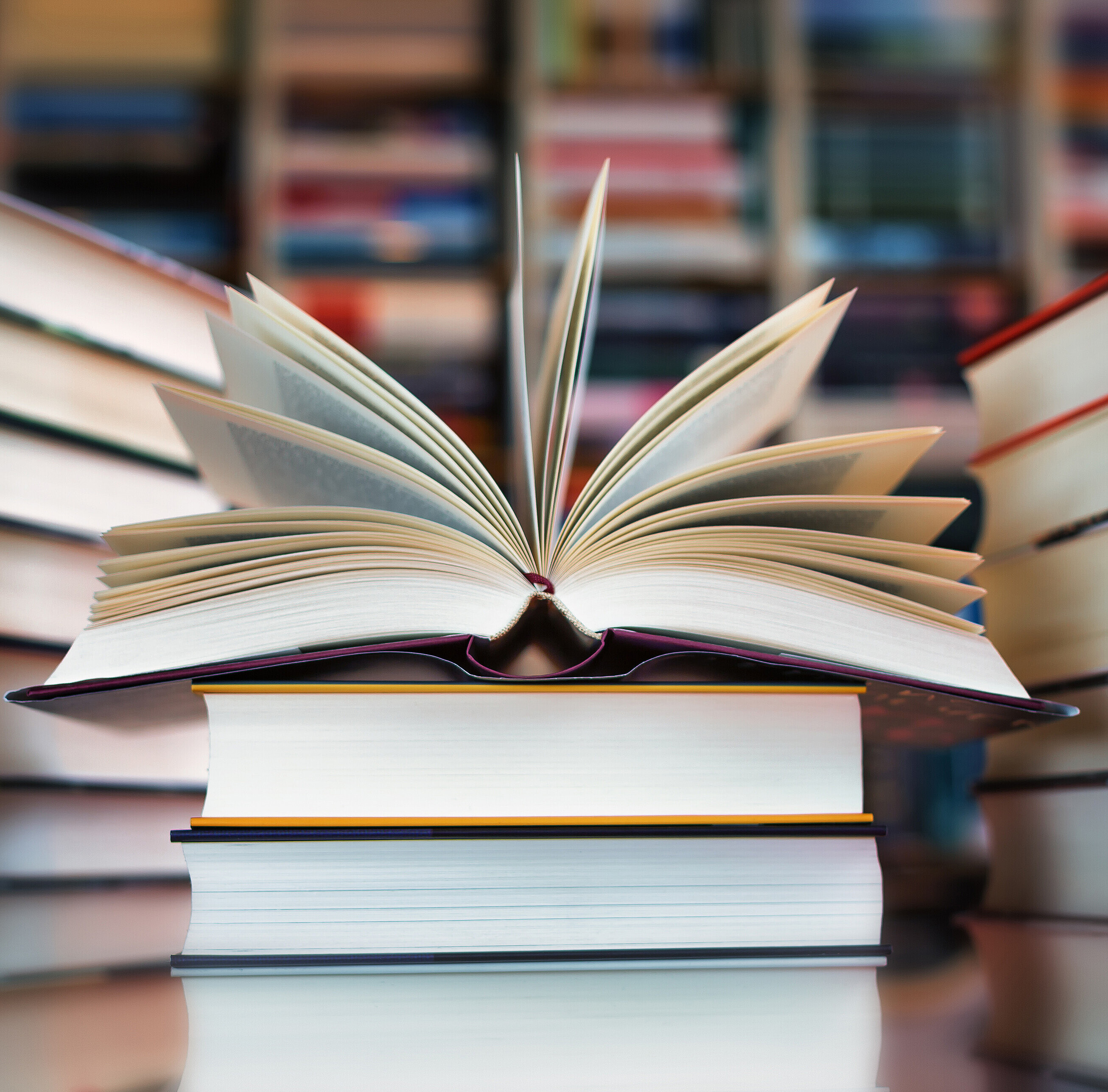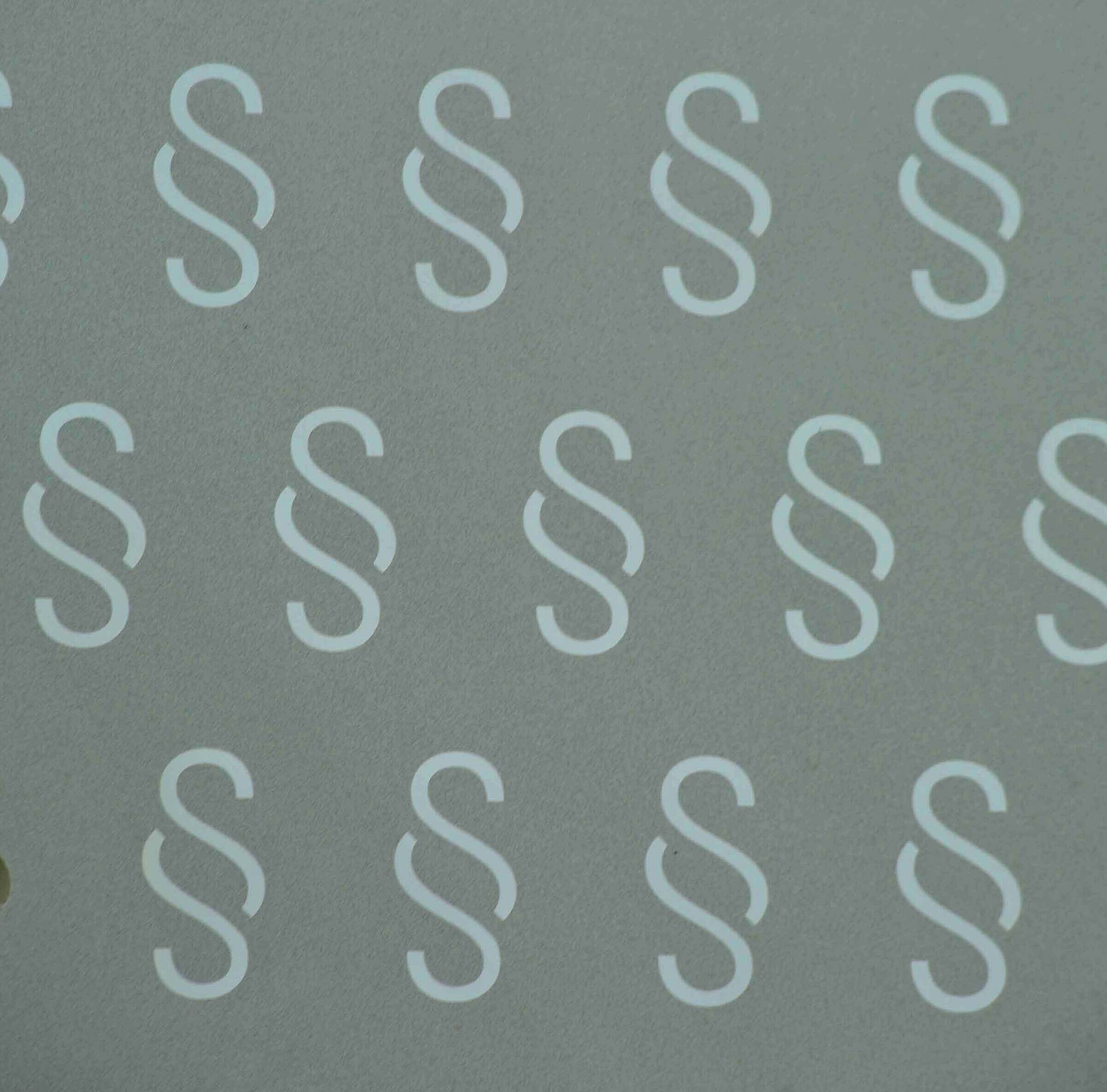Verzug: Die Voraussetzungen im Allgemeinen

Passende Arbeitshilfen
Verzug bzw. Verzugsvoraussetzungen
Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner nach Art. 102 Abs. 1 OR durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt. Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vertragsmässig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages automatisch in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR), weil er auch ohne Aufforderung des Gläubigers (Mahnung) wissen muss, dass die Leistung zu dem Zeitpunkt zu erbringen ist. Ein Verfalltag darf insbesondere dann angenommen werden, wenn im Vertrag ein bestimmte Datum für die Leistung vereinbart wurde oder wenn der Vertrag die Möglichkeit bietet, den Leistungszeitpunkt anhand des Vertragsinhaltes zu ermitteln.
Der Schuldnerverzug setzt somit folgende Elemente voraus:
die Fälligkeit einer Verbindlichkeit
eine Mahnung oder einen bestimmten Verfalltag
das Fehlen verzugsbeseitigender bzw. verzugsausschliessender Gründe
Fall-Beispiel: In dem in BGE 116 II 441 ff. beurteilten Fall verkaufte die A AG zum Preis von DEM 440’000.- der B AG eine Computeranlage, wobei die Lieferung ‹au plus tard le 31 août› vereinbart wurde. Als die A AG bis Ende August nicht lieferte, geriet sie automatisch in Verzug, weil sich die A AG darüber im Klaren sein musste, dass sie bis spätestens Ende August die Verbindlichkeit zu erfüllen hatte.
Die erste Voraussetzung für die Annahme eines Schuldnerverzuges bildet die Fälligkeit der Leistung. Die Leistung ist fällig, wenn der Gläubiger vom Schuldner die Leistung verlangen kann und darf.
Dazu enthält das Gesetz in Art. 75 OR eine Auslegungsregel: Sofern die Parteien über die Zeit der Leistungserbringung nichts vereinbart haben, geht das Gesetz davon aus, dass die Erfüllung sogleich vom Schuldner geleistet und vom Gläubiger gefordert werden kann.
Unter Mahnung versteht man jede an den Schuldner gerichtete Erklärung des Gläubigers, durch die er in unmissverständlicher Weise die unverzügliche Erbringung der fälligen Leistung beansprucht. Die Mahnung muss dem Schuldner inhaltlich nicht nur klar zum Ausdruck bringen, dass der Gläubiger die versprochene Leistung endgültig verlangt, sondern auch deren Quantität, Qualität und Erfüllungsort richtig bezeichnen.
Praxis-Beispiel: Bauer (B) bestellt telefonisch bei dem mit landwirtschaftlichen Produkten handelnden Vischer (V) 50 kg Schweinefutter. V sagt dem B Lieferung ‹in den nächsten Tagen› zu. Als V nach zwei Wochen noch nichts gehört und gesehen hat, ruft er an. Telefonisch verlangt er umgehend Lieferung, da er ansonsten seine Schweine nicht mehr ausreichend ernähren könnte und diese schon sichtlich vom Fleische fallen. Aus Beweisgründen wäre es vorteilhafter, B hätte V eine Mahnung per Mail oder eingeschriebenen Brief geschickt.
Passende Produkt-Empfehlungen
Für die Mahnung ist zwar keine bestimmte Form vorgeschrieben, sie ist auch mündlich gültig. Aus beweisrechtlichen Gründen empfiehlt sich allerdings, Mahnungen immer schriftlich zu verfassen. Die Mahnung setzt den Schuldner allein dann in Verzug, wenn ihm durch diese bewusst wird, dass eine weitere Leistungsverzögerung eine Pflichtverletzung darstellt. Der Schuldner muss also die Möglichkeit bekommen, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen.
Die Voraussetzungen des Verzuges können jederzeit wieder beseitigt werden. Man unterscheidet zwischen folgenden Möglichkeiten:
Der Hauptanwendungsfall ist verspätete Leistung. Durch die Erfüllung der Schuldverpflichtung beseitigt der Schuldner die Verzugsvoraussetzungen, und der Verzug wird aufgehoben. Die bis dahin eingetretenen Verzugsfolgen wie Verzugszinsen oder Ansprüche auf Schadenersatz gemäss Art. 103 Abs. 1 OR bestehen weiter.
Der Gläubiger setzt dem Schuldner nach Art. 107 Abs. 1 OR eine Frist zur verspäteten Leistung inklusive Verzugsfolgeentschädigung verweigert aber bei der Lieferung deren Annahme. Damit gerät der Gläubiger nach Art. 91 OR selbst in Verzug und beseitigt damit den Schuldnerverzug.
Die Leistung ist für den Schuldner unmöglich geworden. Aus dem Schuldnerverzug wird deshalb eine Unmöglichkeit, für die der Schuldner gemäss Art. 103 Abs. 1 OR einstehen muss. Er kann sich von dieser Haftung durch den Nachweis befreien, dass der Verzug ohne jedes Verschulden von seiner Seite eingetreten ist oder dass der Zufall auch bei rechtzeitiger Erfüllung den Gegenstand der Leistung zum Nachteile des Gläubigers betroffen hätte (Art. 103 Abs. 2 OR).