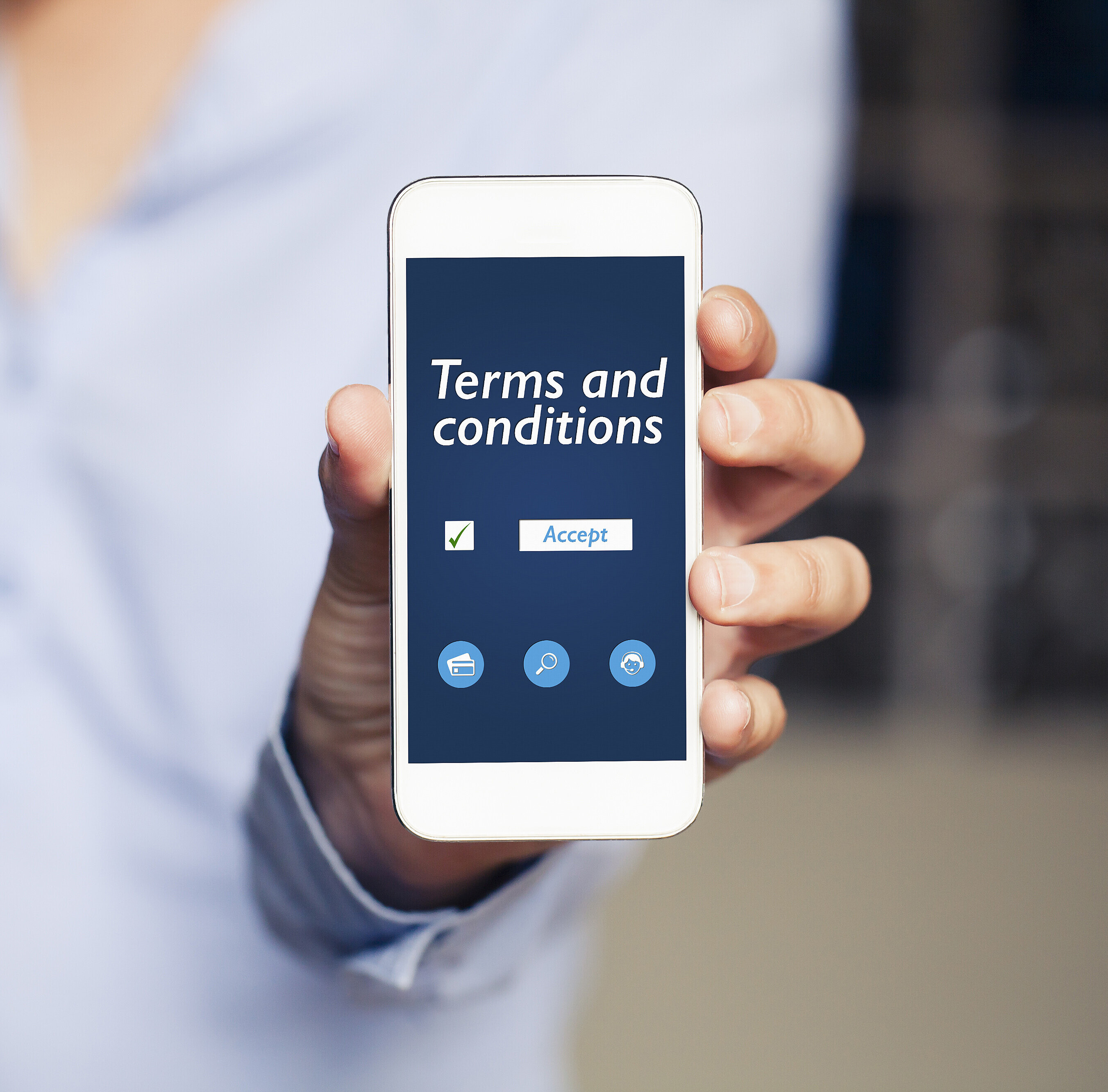Allgemeine Geschäftsbedingungen: Vergessen Sie die Inhaltskontrolle nicht

Passende Arbeitshilfen
Einleitung Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lange war eine Inhaltkontrolle von AGB nur schwer möglich. Das Bundesgericht konnte zwar die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip im Berufungsverfahren überprüfen, war aber dabei an die Feststellungen der Vorinstanz über die äusseren Umstände gebunden (BGE 4C.302/2003 /lma). Sonst hatte die Rechtsprechung eine offene Inhaltskontrolle der allgemeinen Geschäftsbedingungen weitgehend abgelehnt, mit Ausnahme der Unklarheits- und Aussergewöhnlichkeitsregel.
Eine offene Inhaltskontrolle wurde bisher nur vereinzelt durchgeführt, indem über ausdrückliche zwingende gesetzliche Regelungen entschieden wurde oder über die Generalklauseln der Sittenwidrigkeit und der Persönlichkeitsverletzung nach Art. 27 ZGB. Ausserdem wurde eine Inhaltskontrolle in der Lehre wegen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung befürwortet. Nach Art. 19 Abs. 2 OR sind von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen nur zulässig, wenn das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung keinen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst. Das gilt heute noch und nach Art. 20 OR ist ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, nichtig. Betrifft der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
Allgemeine Geschäftsbedingungen haben von sich heraus keine Geltung zwischen den Parteien. Sie gelten nur und soweit, als die Parteien sie für ihren Vertrag ausdrücklich oder konkludent übernommen haben (4A_330/2021 vom 5. Januar 2022). Damit bestätigte das Bundesgericht eine langjährige Rechtssprechung.
Nach Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb handelt man unlauter, wenn in den AGB auf Treu und Glauben verletzende Weise ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zum Nachteil der Konsumenten zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorgesehen wird (Art. 8 UWG).
Eine Spezialbestimmung enthält Art. 8 a UWG: Unlauter handelt insbesondere, wer als Betreiber einer Online-Plattform zur Buchung von Beherbergungsdienstleistungen allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, welche die Preis- und Angebotssetzung von Beherbergungsbetrieben durch Paritätsklauseln, namentlich bezüglich Preis, Verfügbarkeit oder Konditionen, direkt oder indirekt einschränken.
Beispiel: Versicherungsklausel über Deckungsausschluss
Schon seit längerer Zeit bestehen in der Schweiz Regeln für missbräuchliche AGB. So wurde vom Bundesgericht aus dem Vertrauensprinzip die Unklarheitenregel und die Ungewöhnlichkeitsregel entwickelt. Im Urteil 4A_503/2020 vom 19. Januar 2021 findet man folgende Aussage: „Nach zeitgemässem Methodenverständnis, das auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde liegt, gibt es den "klaren" Vertragswortlaut, der von vornherein keiner Auslegung bedarf, nicht; auch der klare Wortsinn ist für die Vertragsauslegung nicht allein massgebend.“ Und weiter in demselben Urteil: „Demnach gilt: Geben die Parteien individuelle Willensäusserungen ab, kann dies nach dem Vertrauensprinzip vernünftigerweise nur so gedeutet werden, dass diese konkreten Erklärungen dem anderslautenden Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen sollen.“
Im Urteil 4A_330/2021 vom 5. Januar 2022 ging es um Deckungsausschlüsse einer Versicherung während der Coronazeit. Die Fahrhabeversicherung umfasste laut Police von 2018 unter der Rubrik "Weitere Gefahren" auch die Versicherung für Ertragsausfall und Mehrkosten infolge Epidemie. Die vom Bundesrat verordnete Betriebsschliessung ab 17. März 2020 führte beim Kläger zu einem Ertragsausfall. Mit Urteil vom 17. Mai 2021 hiess das Handelsgericht die Klage gut und verpflichtete die Versicherung, dem Kläger Fr. 40'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 24. April 2020 zu bezahlen. Dagegen erhob die Versicherung Beschwerde an das Bundesgericht.
In diesem Urteil äusserte sich das Bundesgericht zur Ungewöhnlichkeitsregel: „Diese ist ein Instrument der Konsenslehre. Sie konkretisiert das Vertrauensprinzip. Dieses bezweckt den Schutz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr und zielt nicht primär darauf ab, die schwächere oder unerfahrene Partei vor der stärkeren oder erfahreneren zu schützen.
In der Rubrik "Versichert sind" hält die Klausel B1 auf Seite 5 unter dem hervorgehobenen Titel "Epidemie" fest, dass Schäden versichert sind "infolge von Massnahmen, die eine zuständige schweizerische oder liechtensteinische Behörde aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verfügt, um durch: a) Schliessung oder Quarantäne von Betrieben oder Betriebsteilen sowie Einschränkungen der betrieblichen Tätigkeit [...] die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern".
In der Rubrik "Nicht versichert sind" umschreibt auf Seite 7 die Klausel B2 ebenfalls unter dem hervorgehobenen Titel "Epidemie", welche Risiken in diesem Bereich vom Versicherungsschutz ausgenommen sind. Nicht versichert sind laut Klausel B2 "Schäden infolge von Influenza-Viren und Prionkrankheiten (Scrapie, Rinderwahnsinn, Creutzfeldt-Jakob usw.) sowie infolge Krankheitserregern für welche national oder international die WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten".
Das Bundesgericht hatte zu beurteilen, ob die COVID-19-Pandemie die Voraussetzungen der Stufe 5 oder 6 gemäss WHO-Pandemiestufensystem erfüllen und demnach der Deckungsausschluss nach der Klausel B2 der Zusatzbedingungen möglich ist. Es kam zum Schluss: Unter Berücksichtigung des Zwecks der Bestimmung ist somit klar, wie die Klausel B2 der Zusatzbedingungen zu verstehen ist: Dem Versicherten musste klar sein, dass von der grundsätzlichen Deckung der Schäden bei Epidemien (Klausel B1) die gravierendsten Risiken ausgenommen sind, nämlich nach der Klausel B2 Pandemien, die als WHO-Pandemiestufen 5 und 6 beurteilt werden. Dass dieses Stufensystem von der WHO bereits bei Vertragsschluss nicht mehr im Gebrauch war, ändert an diesem Auslegungsergebnis nichts.“ Die Beschwerde der Versicherung wurde gutgeheissen.
Passende Produkt-Empfehlungen
Allgemeine Regeln für AGB
Weiter legt das Bundesgericht im oben besprochenen Urteil 4A_503/2020 auch allgemeine Regeln für die Auslegung von AGB fest, womit auch die bisherige Rechtssprechung bestätigt wird.
Wichtig: Für die Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel braucht es sich beim Zustimmenden nicht zwingend um eine schwächere oder unerfahrene Partei zu handeln. Auch eine stärkere, geschäfts- oder branchenerfahrene Vertragspartei kann von einer global übernommenen Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen überrascht werden und die Ungewöhnlichkeitsregel. Die Stellung und Erfahrung des Zustimmenden ist dennoch nicht irrelevant, sondern spielt bei der subjektiven Ungewöhnlichkeit eine Rolle.
Weitere Regeln:
Die AGB-Klausel hat für die zustimmende Partei zunächst subjektiv ungewöhnlich zu sein. Je weniger geschäfts- oder branchenerfahren er ist, umso eher wird eine Klausel für ihn ungewöhnlich sein. So können branchenübliche Klauseln für einen Branchenfremden ungewöhnlich sein, für einen Branchenkenner demgegenüber nicht. Branchenkenntnis oder Geschäftserfahrung schliesst aber die Ungewöhnlichkeit nicht zwingend aus. Auch für einen Branchenkundigen oder Geschäftserfahrenen kann eine AGB-Klausel unter Umständen ungewöhnlich sein.
Neben der subjektiven Ungewöhnlichkeit hat die fragliche Klausel objektiv beurteilt einen geschäftsfremden Inhalt aufzuweisen, damit die Ungewöhnlichkeitsregel zur Anwendung gelangt. Sie hat mithin objektiv ungewöhnlich zu sein. Dies ist dann zu bejahen, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Vertragscharakters führt oder in erheblichem Masse aus dem gesetzlichen Rahmen des Vertragstypus fällt. Je stärker eine Klausel die Rechtsstellung des Vertragspartners beeinträchtigt, desto eher ist sie als ungewöhnlich zu qualifizieren.
Bei Versicherungsverträgen sind auch die berechtigten Deckungserwartungen zu berücksichtigen. Entsprechend kann eine in allgemeinen Versicherungsbedingungen vorgesehene Haftungsbeschränkung als ungewöhnlich qualifiziert werden, wenn der durch die Bezeichnung und Werbung beschriebene Deckungsumfang erheblich reduziert wird, so dass gerade die häufigsten Risiken nicht mehr gedeckt sind. Der Versicherer haftet für alle Ereignisse, welche die Merkmale der versicherten Gefahr an sich tragen, es sei denn, dass der Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung von der Versicherung ausschliesst. Es ist somit am Versicherer, die Tragweite der Verpflichtung, die er eingehen will, genau zu begrenzen.
Entscheidend ist in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Wille der Vertragsparteien und in zweiter Linie, falls ein solcher nicht festgestellt wird, die Auslegung der Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips. Die Erklärungen der Parteien sind so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten.
Mehrdeutige Wendungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Zweifel zu Lasten jener Partei auszulegen, die sie verfasst hat (Unklarheitsregel). Die Unklarheitsregel kommt jedoch nur subsidiär zur Anwendung, wenn sämtliche übrigen Auslegungsmittel versagen. Es genügt nicht, dass die Parteien über die Bedeutung einer Erklärung streiten, sondern es ist vorausgesetzt, dass die Erklärung nach Treu und Glauben auf verschiedene Weise verstanden werden kann.
Fazit: Allgemeine Geschäftsbedingungen klar formulieren
Nach der Ungewöhnlichkeitsregel sind AGB-Klauseln nicht bindend, wenn Betroffene nach den Umständen mit der darin enthaltenen Regelung nicht rechnen mussten. Unklarheiten in den AGB gehen zu Lasten des Verfassers der AGB.
Diese Regeln hat das Bundesgericht in diesem Jahrhundert immer wieder bestätigt, siehe oben Urteil 4A_330/2021. Klauseln, welche die Rechte von Kunden beschränken, müssen klar und eindeutig und für den Kunden verständlich formuliert werden. Um gültig zu sein müssen die ungewöhnlichen Klauseln betont werden, z.B. fett gedruckt. Noch besser ist ein Hinweis, dass es sich um eine ungewöhnliche Klausel handelt.
Wichtig: Der Vertrauensschutz erfordert nach Bundesgericht, dass eine Regelung, die vor Inkrafttreten einer Gesetzesänderung bestand, nach dem früheren Recht beurteilt wird (BGE 140 III 404 vom 15. Juli 2014).