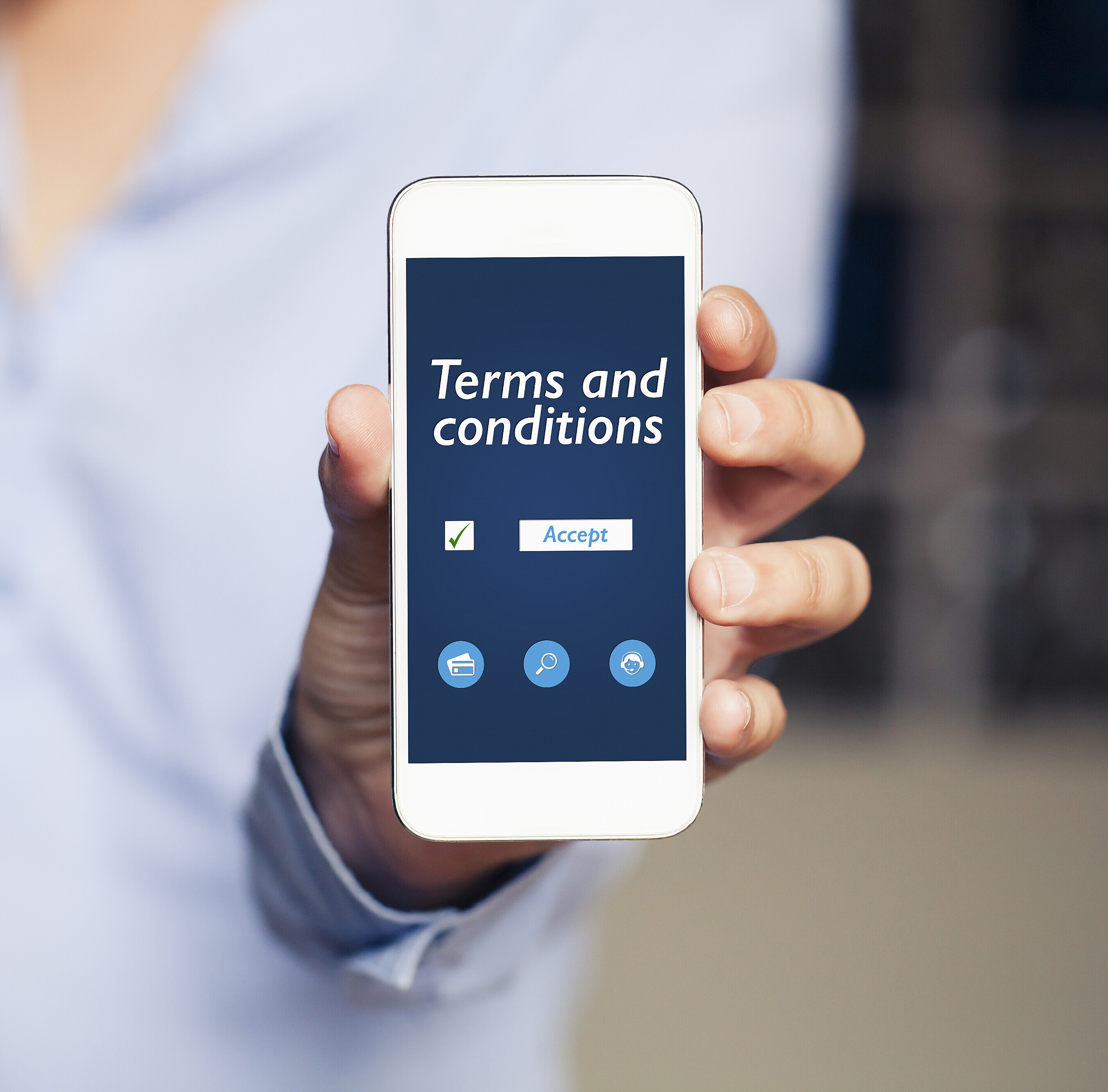AGB Spezialprobleme: Gerichtsstandsvereinbarungen

Passende Arbeitshilfen
Schiedsgerichte
Möglich sind auch Schiedsgerichtsvereinbarungen (Art. 61 ZPO). Haben die Parteien über eine schiedsfähige Streitsache eine Schiedsvereinbarung getroffen, so lehnt das angerufene staatliche Gericht seine Zuständigkeit ab, es sei denn
die beklagte Partei habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen
das Gericht stelle fest, dass die Schiedsvereinbarung offensichtlich ungültig oder nicht erfüllbar sei; oder
das Schiedsgericht könne nicht bestellt werden aus Gründen, für welche die im Schiedsverfahren beklagte Partei offensichtlich einzustehen hat.
Im Bundesgerichtsurteil 4A_342/2019 vom 6. Januar 2020 werden einige Grundsätze für Schiedsgerichtsvereinbarungen erwähnt, wobei auch bisherige Rechtssprechung bestätigt wird:
Unter einer Schiedsvereinbarung ist eine Übereinkunft zu verstehen, mit der sich zwei oder mehrere bestimmte oder bestimmbare Parteien einigen, eine oder mehrere, bestehende oder künftige Streitigkeiten verbindlich unter Ausschluss der ursprünglichen staatlichen Gerichtsbarkeit einem Schiedsgericht nach Massgabe einer unmittelbar oder mittelbar bestimmten rechtlichen Ordnung zu unterstellen. Entscheidend ist, dass der Wille der Parteien zum Ausdruck kommt, über bestimmte Streitigkeiten ein Schiedsgericht, d.h. ein nichtstaatliches Gericht, entscheiden zu lassen.
Die Auslegung einer Schiedsvereinbarung folgt den für die Auslegung privater Willenserklärungen allgemein geltenden Grundsätzen. Massgebend ist danach in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Steht bezüglich der Schiedsvereinbarung kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien fest, so ist diese nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Wille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste.
Bei der Auslegung einer Schiedsvereinbarung ist zu beachten, dass mit dem Verzicht auf ein staatliches Gericht die Rechtsmittelwege stark eingeschränkt werden. Ein solcher Verzichtswille kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht leichthin angenommen werden, weshalb im Zweifelsfall eine restriktive Auslegung geboten ist.
Steht demgegenüber als Auslegungsergebnis fest, dass die Parteien die Streitsache von der staatlichen Gerichtsbarkeit ausnehmen und einer Entscheidung durch ein Schiedsgericht unterstellen wollten, bestehen jedoch Differenzen hinsichtlich der Abwicklung des Schiedsverfahrens, greift grundsätzlich der ist möglichst ein Vertragsverständnis zu suchen, das die Schiedsvereinbarung bestehen lässt.
Was gilt als Konsumentenvertrag?
Nach ZPO Art. 32 sind bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen folgende Gerichte zuständig:
für Klagen des Konsumenten das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien
für Klagen des Anbieters: das Gericht am Wohnsitz der beklagten Partei.
Als Konsumentenverträge gelten Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für die persönlichen oder familiären Bedürfnisse der Konsumenten bestimmt sind und von der anderen Partei im Rahmen ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit angeboten werden.
Für Klagen aus Miete und Pacht unbeweglicher Sachen ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache zuständig (Art. 33 ZPO) und für arbeitsrechtliche Klagen der Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder an dem Ort, an dem der Angestellte gewöhnlich die Arbeit verrichtet (Art. 34 ZPO).
Wichtig: Auf die Gerichtsstände nach den Art. 32–34 ZPO können folgende Parteien nicht zum Voraus oder durch Einlassung auf das Verfahren verzichten (Art. 35 ZPO):
Konsumenten
Parteien, die Wohn- oder Geschäftsräume gemietet oder gepachtet haben
bei landwirtschaftlichen Pachtverhältnissen: die pachtende Partei
stellensuchende oder arbeitnehmende Personen
Vorbehalten bleibt der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung nach Entstehung der Streitigkeit.
Seminar-Empfehlungen
AGB Spezialprobleme Beispiel: Bundesgerichtsurteil 4A_503/2020 Urteil vom 19. Januar 2021
In diesem Fall wurde in den AGB des privaten Unternehmens als Gerichtsstand das Handelsgericht Zürich genannt. Der Prozessgegner gehörte zur Bundesverwaltung und in deren AGB heisst es: In Ziffer 23.2 der AGB der Bundesverwaltung hiess es: "Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern." Das führte im Prozess zu Zuständigkeitskonflikten und so gelangte dieser an das Bundesgericht. Dieses stellte folgendes fest und bestätigte damit auch die bisherige Rechtssprechung:
Die Parteien haben die Zuständigkeit eines Handelsgerichts vereinbart. Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte ist der Disposition der Parteien grundsätzlich entzogen. Umstritten war in diesem Fall die örtliche Zuständigkeit.
In diesem Fall konnte die Zusammenarbeitsvereinbarung von den Parteien nach Treu und Glauben grundsätzlich so verstanden werden, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung zuständig ist. Das Bundesgericht gab der Vorinstanz recht, die den Vorrangs von Individualabreden vor vorformulierten Klauseln aus allgemeinen Geschäftsbedingungen bejahte. Geben die Parteien individuelle Willensäusserungen ab, kann dies nach dem Vertrauensprinzip vernünftigerweise nur so gedeutet werden, dass diese konkreten Erklärungen dem anderslautenden Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen sollen.
Die Vereinbarung eines Gerichtsstands gründet auf der übereinstimmenden Willenserklärung der Parteien. Für Fragen des Konsenses und der Auslegung ist - wie bei anderen Verträgen - zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Steht kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien fest, so sind ihre Erklärungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Ob ein gültiger Verzicht auf den gesetzlichen Gerichtsstand vorliegt, hängt davon ab, ob der Vertragspartner des Verzichtenden in guten Treuen annehmen durfte, sein Kontrahent habe mit der Annahme des Vertrags auch der Gerichtsstandsvereinbarung zugestimmt. Für das Zustandekommen einer Prorogation ist erforderlich, dass die Parteien hinreichend klar bestimmen, welches Gericht sie als zuständig erklären, damit das angerufene Gericht zweifelsfrei seine Zuständigkeit feststellen kann.
In diesem Zusammenhang ist auf den neuen Art. 6 ZPO hinzuweisen, der seit Januar 2025 in Kraft ist. Die Kantone können ein Fachgericht bezeichnen, welches als einzige kantonale Instanz für handelsrechtliche Streitigkeiten zuständig ist (Handelsgericht).
Eine Streitigkeit gilt als handelsrechtlich, wenn:
die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist;
der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt oder es sich um eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit handelt
die Parteien als Rechtseinheiten im schweizerischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind und es sich nicht um eine Streitigkeit aus dem Arbeitsverhältnis oder aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen oder aus landwirtschaftlicher Pacht handelt.
Ist nur die beklagte Partei als Rechtseinheit im schweizerischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen, sind aber die übrigen Voraussetzungen erfüllt, so kann die klagende Partei zwischen dem Handelsgericht und dem ordentlichen Gericht wählen. Nach Art. 9 und 17 ZPO spricht nichts dagegen, dass man das schon in einer Gerichtsstandsvereinbarung festlegt, sofern der Gerichtsstand nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass später ein Gericht das Wahlrecht als obligatorisch betrachtet.
Internationale Gerichtsstandsvereinbarung
Das Bundesgericht urteilte am 1. Juli 2013 über eine internationale Gerichtsstandvereinbarungen (BGE 139 III 345 S. 345). Ist eine Gerichtsstandsklausel in der AGB enthalten, so setzt die Einhaltung der Formerfordernisse von Art. 23 Abs. 1 lit. a LugÜ voraus, dass der AGB-Verwender seinem Vertragspartner vor Vertragsabschluss eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme der AGB verschafft. Das Bundesgericht prüfte die Frage, ob Prüfung der Frage, ob ein Zugänglichmachen mit dem Hinweis, die AGB könnten auf der Internetseite des Verwenders abgerufen oder über eine Faxnummer angefordert werden, eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme darstellt.
Art. 23 LugÜ schreibt vor, dass eine Gerichtsstandsvereinbarung schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung oder in einer Form, welche den Gepflogenheiten zwischen den Parteien entspricht, zu treffen ist. Im internationalen Handel ist eine Form anzuwenden, die einem Handelsbrauch entspricht, den die Parteien kannten oder kennen mussten. Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung ermöglichen, sind der Schriftform gleichgestellt.
Die Rechtsprechung des EuGH zu dieser Bestimmung ist dabei grundsätzlich auch von den schweizerischen Gerichten zu beachten (BGE 138 III 386 E. 2.6 S. 392, BGE 138 III 304 E. 5.3.1 S. 313; BGE 136 III 523 E. 4 S. 524; BGE 135 III 185 E. 3.2; je mit Hinweisen).
Nach Bundesgericht gelten folgende Regeln:
Kommunizieren die Parteien per E-Mail, besteht nur ein vernachlässigbarer Unterschied zwischen dem Öffnen eines dem E-Mail beigefügten Dokuments, das die AGB enthält, und dem Aufrufen der Internetseite des AGB-Verwenders oder dem Anklicken eines entsprechenden Links. Unter diesen Voraussetzungen ist es dem Vertragspartner zumutbar, einem Hinweis des AGB-Verwenders auf seine Internetseite nachzugehen und die AGB dort zur Kenntnis zu nehmen.
Im Vergleich mit dem Abruf der AGB auf dem Internet ist die Bestellung der AGB per Fax umständlicher. Der Fax ist vom AGB-Verwender zu beantworten, was eine Zeitverzögerung bewirkt. Dazu ist der Vertragspartner zur Nachfrage beim AGB-Verwender gezwungen und kann nicht ohne dessen Zutun von den AGB Kenntnis nehmen. Faxgeräte sind nicht mehr so verbreitet sind wie elektronische Geräte mit Internetzugang. Aus diesen Gründen stellt der Hinweis, die AGB könnten unter einer bestimmten Faxnummer abgerufen werden, keine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme dar und genügt den strengen Formerfordernissen des Art. 23 Abs. 1 lit. a LugÜ nicht.
Es kann dem Verwender der AGB, wenn dieser die AGB zum Vertragsbestandteil machen will, zugemutet werden, diese entweder im Internet einfach und schnell zugänglich aufzuschalten oder aber dem Vertragspartner zusammen mit dem Vertrag, gegebenenfalls elektronisch, zuzustellen.
Wichtig: Nach Gesetz über das Internationale Privatrecht (Art. 120 IPRG) gilt für Konsumentenverträge folgendes und eine Rechtswahl ist ausgeschlossen: Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn der Anbieter die Bestellung in diesem Staat entgegengenommen hat, wenn in diesem Staat dem Vertragsabschluss ein Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und der Konsument in diesem Staat die zum Vertragsabschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat, oder wenn der Anbieter den Konsumenten veranlasst hat, sich ins Ausland zu begeben und seine Bestellung dort abzugeben.