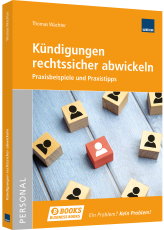Sperrfristen bei Krankheit: Bei Arbeitsunfähigkeit kündigen

Passende Arbeitshilfen
Sperrfristen bei Krankheit
Der Kündigungsschutz dauert (mit Ausnahme der Probezeit) so lange wie die Arbeitsunfähigkeit. Er wird aber durch die gesetzlichen Maximalfristen begrenzt. Diese Maximalfristen sind nach Dienstjahren abgestuft:
- 30 Tage im 1. Dienstjahr
- 90 Tage vom 2. bis und mit 5. Dienstjahr
- 180 Tage ab dem 6. Dienstjahr
Ist die Sperrfrist abgelaufen, kann die Kündigung ausgesprochen werden, selbst wenn die Arbeitsunfähigkeit noch andauert.
Praxis-Beispiel
Ein Mitarbeiter im 7. Anstellungsjahr erkrankt ernsthaft. Nach 13 Wochen ist die Lohnfortzahlung abgelaufen. Der Arbeitgeber will ihm kündigen. Kann er die Kündigung aussprechen? Antwort: Nein, eine Kündigung wäre ungültig. Er muss warten, bis die Sperrfrist von 180 Tagen abgelaufen ist. Anschliessend ist eine Kündigung rechtsgültig, auch wenn die Krankheit noch andauert.
Geschützt ist nicht nur die volle Arbeitsverhinderung, sondern auch die teilweise, unabhängig vom Grad ihres Ausmasses (Art. 336c Abs. 1 lit. b OR). Umstritten ist, ob auch geringfügige Arbeitsverhinderungen eine Sperrfrist auslösen.
Frage aus der Praxis: Wir möchten einem Mitarbeiter kündigen, der krankgeschrieben war. Im Arztzeugnis steht, dass er zu 100 Prozent arbeitsfähig, aber nur zu 75 Prozent leistungsfähig ist, mit dem Zusatz “diese Arbeitsunfähigkeit dauert vorläufig drei Monate”. Kommt bei diesem Mitarbeiter nun die Sperrfrist wegen Krankheit zur Anwendung?
Antwort: Ja, die Sperrfrist kommt bei vollständiger wie bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit zur Anwendung (Art. 336c Abs. 1 lit. b OR).
Passende Produkt-Empfehlungen
Voraussetzung unverschuldete Arbeitsverhinderungen
Die Sperrfrist kommt nur zum Tragen, wenn die Arbeitsunfähigkeit ohne eigenes Verschulden eingetreten ist.
Dies wird bei Krankheit generell vermutet, da eine Differenzierung praktisch unmöglich ist. Lehre und Rechtsprechung lassen denn auch ansteckende Krankheiten wie Aids, Suchtkrankheiten wie z.B. Schäden durch Rauchen oder Alkoholismus sowie psychische Erkrankungen als unverschuldet gelten.
Vom Schutz erfasst sind auch unverschuldete Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle. Im Gegensatz zur Krankheit lässt sich bei einem Unfall in der Regel einfacher feststellen, ob es sich um einen selbst verschuldeten gehandelt hat oder nicht. Als unverschuldet gelten solche, die bei Beobachtung eines normalen Risikos eintreten können, z.B.:
- Normale Sportarten (Fussball, Skifahren, Bergsteigen, Tauchen, Deltafliegen).
- Verkehrsunfälle bei nur leichtem Verschulden.
- Selbstmordversuch (bei nicht selbst verschuldetem Zustand völliger Unzurechnungsfähigkeit).
- Verletzungen bei Ausübung von normalen Heimwerkerarbeiten.
Ist die Unfallgefahr hingegen sehr erheblich oder sogar sicher verschuldet, wird in der Regel von einem Selbstverschulden ausgegangen, z.B.:
- Bei aktiver Teilnahme an Raufereien oder Schlägereien.
- Motocrossfahren, Auto- und Motorradrennen.
- Verkehrsunfall mit grobem Verstoss gegen die Verkehrsregeln oder in angetrunkenem Zustand (FiaZ).
- Missachtung elementarster Sicherheitsmassnahmen, wie beispielsweise Fahren ohne Sicherheitsgurten oder Helm, Bergsteigen ohne Seil, Schweissarbeiten ohne Schutzbrille usw.
- Bewusste Missachtung von Suva- und anderen Vorschriften.
- Missachtung von ärztlichen Weisungen bei gesundheitlichen Schwächen oder Gebrechen.
- Absichtliche Selbstverstümmelung.
- Selbstmordversuch bei vollem Bewusstsein über die Tat.
Geht der Arbeitnehmer ein derartiges Risiko ein, ist er nicht zulasten des Arbeitgebers zu schützen. Ob der Unfall während der Arbeitszeit oder in der Freizeit erfolgt, spielt keine Rolle.
Aktuelle Rechtsprechung: Keine Sperrfrist bei arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit
Ein aktueller Entscheid des Bundesgerichts vom 26. März 2024 (Urteil 1C_595/2023) verdeutlicht, dass nicht jede ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit automatisch den Kündigungsschutz durch eine Sperrfrist auslöst. Im konkreten Fall ging es um einen Instruktor der Schweizer Armee, dem jahrelange Falschangaben zu einer privaten Vorstandstätigkeit vorgeworfen wurden. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis per 30. November 2022 und setzte es mit sofortiger Wirkung aus.
Gemäss ärztlichen Zeugnissen war der Mitarbeitende ab dem 25. August 2021 zu 50 %, ab dem 2. September 2021 zu 100 % arbeitsunfähig. Das Bundesgericht hielt dennoch fest: Die Sperrfrist gemäss Art. 336c OR (bzw. Art. 31a Abs. 1 BPV für öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnisse) greift in diesem Fall nicht, da die Einschränkung nur auf den konkreten Arbeitsplatz bezogen war. Eine Anstellung bei einem anderen Arbeitgeber wäre grundsätzlich möglich gewesen.
Kernaussage:
Die gesetzliche Sperrfrist schützt Arbeitnehmende, die infolge gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht oder kaum vermittelbar sind. Ist die Arbeitsunfähigkeit hingegen rein arbeitsplatzbezogen, entfällt der besondere Kündigungsschutz – auch wenn eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit im Arztzeugnis steht.
Praxisrelevanz:
HR-Verantwortliche sollten bei Kündigungen im Krankheitsfall stets differenzieren: Liegt eine generelle Arbeitsunfähigkeit vor oder betrifft sie nur den bisherigen Einsatzbereich? Diese Abgrenzung kann entscheidend sein für die Gültigkeit der Kündigung.