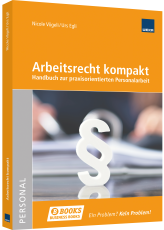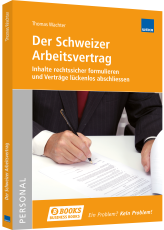Elektronische Signatur: Formvorschriften in Arbeitsverträgen

Passende Arbeitshilfen
Allgemeines
Grundsatz: keine Formvorschriften
Als allgemeine Regel gilt, dass Verträge gemäss Art. 11 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) nicht schriftlich abgefasst werden müssen, um gültig zu sein. Erforderlich ist einzig der Konsens, d.h. die gegenseitige übereinstimmende Willenserklärungen aller beteiligten Parteien. Die Schriftlichkeit ist nur dann erforderlich, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn die Parteien vertraglich eine solche Formvorschrift vereinbaren.
Schriftform
Das OR unterscheidet zwischen drei Kategorien der Schriftform:
- Einfache Schriftlichkeit: Diese Form setzt voraus, dass der Vertrag die eigenhändige Unterschrift sämtlicher Parteien trägt, die mit dem Vertrag gebunden sein wollen.
- Qualifizierte Schriftlichkeit: Diese Form erfordert ferner, dass der Inhalt des Vertrags handschriftlich abgefasst ist (z.B. ein Testament) oder dass der Vertrag bestimmte inhaltliche Elemente enthält (z.B. Bestimmungen über die Dauer und die Beendigung des Handelsreisendenvertrags [Art. 347a Abs. 1 OR]).
- Öffentliche Beurkundung: Diese Form erfordert, dass die Willenserklärungen der Parteien in einer besonderen Form durch einen Notar festgehalten werden. Sie ist für Rechtsgeschäfte erforderlich, die nach Schweizer Recht von grösserer Bedeutung sind (z.B. der Erwerb von Grundstücken).
Grundsätzlich gilt: Ist die Schriftlichkeit gesetzlich vorgeschrieben oder vertraglich als Formerfordernis vereinbart worden, muss der betreffende Vertrag die eigenhändige Unterschrift aller beteiligten Parteien beinhalten (Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 OR). Ist dies nicht der Fall, ist der Vertrag nicht gültig (Art. 11 Abs. 2 OR).
Tipp: In der Praxis werden die meisten Verträge schriftlich abgeschlossen. Damit soll die Rechtssicherheit sowohl intern zwischen den Parteien als auch extern im Falle eines Rechtsstreits, der möglicherweise einer gerichtlichen Entscheidung bedarf, gewährleistet werden. Darüber hinaus ist die Beweiskraft in Bezug auf den Abschluss und Inhalt eines Vertrags stärker, wenn dieser schriftlich abgefasst wird.
Formvorschriften im Arbeitsrecht
Grundsatz: Formfreiheit
Das Gesetz verlangt nicht, dass ein gewöhnlicher Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart werden muss. Ein mündlicher Arbeitsvertrag ist grundsätzlich gültig und bindend. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Beweiskraft sind mündliche Arbeitsverträge jedoch eher selten. Sodann kann ein Arbeitsvertrag auch ohne entsprechende Willenserklärungen der Parteien aufgrund der gesetzlichen Vermutung von Art. 320 Abs. 2 OR zustande kommen. Ein sogenanntes faktisches Arbeitsverhältnis entsteht, wenn der Arbeitgeber Arbeit als Dienst entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist.
Ausnahmen
Bestimmte Verpflichtungen eines typischen Arbeitsvertrags müssen nach dem Gesetz jedoch in einfacher Schriftlichkeit zwischen den Parteien vereinbart werden, damit sie gültig sind. Dies gilt insbesondere für die folgenden Verpflichtungen:
- die Abtretung von Rechten an geistigem Eigentum durch den Arbeitnehmer (Art. 165 Abs. 1 OR, Art. 332 Abs. 2 OR)
- Einschränkungen, die nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten sollen wie z.B. Konkurrenz- oder Abwerbeverbote
- (teilweiser) Ausschluss bzw. Verzicht auf eine Kompensation (entweder in Form von Freizeit oder monetär) für Überstundenarbeit (Art. 321c Abs. 3 OR)
- die Verlängerung der Probezeit über die gesetzliche Dauer von einem Monat hinaus sowie die Verlängerung der Kündigungsfrist während der Probezeit (Art. 335b Abs. 2 OR)
Passende Produkt-Empfehlungen
Zusätzlich müssen die folgenden besonderen Arbeitsverträge vollständig in einfacher oder sogar in qualifizierter Schriftlichkeit abgeschlossen werden:
- Lehrverträge (Art. 344a Abs. 1 OR), wobei die meisten Lehrverträge dem Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) unterstellt sind. Da gemäss Art. 8 Abs. 6 der Berufsbildungsverordnung (BBV) kantonale Formulare für den Abschluss eines Lehrvertrags verwendet werden müssen, ist die Formvorschrift in der Praxis nicht von Bedeutung.
- Verträge über Leih- und Temporärarbeit (Art. 19 Abs. 1 AVG i.V.m. Art. 48 Abs. 2 AVV; ausser wenn zeitliche Dringlichkeit vorliegt oder der Arbeitseinsatz nicht mehr als sechs Stunden dauert) und Handelsreisendenverträge (Art. 347a Abs. 2 OR): Zu beachten ist aber, dass Verträge über Leih- und Temporärarbeit sowie Handelsreisendenverträge bei fehlender Schriftlichkeit nicht ungültig, sondern zu gewöhnlichen Einzelarbeitsverträgen gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den üblichen Arbeitsbedingungen umgedeutet werden. Die Schriftlichkeit ist hier ausnahmsweise keine Gültigkeitsvoraussetzung.
- Heuerverträge nach Art. 69 Abs. 2 Seeschifffahrtsgesetz (SSG)
Schliesslich beinhalten Arbeitsverträge oft vertragliche Formvorschriften in Bezug auf die Beendigung oder eine Änderung des Vertrags. Besteht ein solcher Schriftformvorbehalt, gilt die Vermutung, dass die Parteien vor dessen Erfüllung nicht verpflichtet sein wollen (Art. 16 Abs. 1 OR).
Tipp: Als Ausnahme zur allgemeinen Rechtsfolge der Ungültigkeit nach Art. 11 OR statuiert Art. 320 Abs. 3 OR, dass ein (form-)ungültiger Arbeitsvertrag bei Gutgläubigkeit des Arbeitnehmers wie ein gültiger behandelt wird, bis das Rechtsverhältnis wegen Ungültigkeit des Vertrags von einer Partei aufgehoben wird.
Elektronische Signatur
Für den Fall, dass die Schriftform erforderlich (oder sinnvoll) ist, kann die Unterschrift auch in elektronischer Form erfolgen. Elektronische Unterschriften sind im Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) geregelt. Eine elektronische Signatur bestätigt im Wesentlichen die Identität der unterzeichnenden Person und die Nachvollziehbarkeit der signierten Informationen, d.h. den Gegenstand der Signatur und ob der Inhalt seit der Signierung verändert wurde.
Es werden vier verschiedene Formen der elektronischen Signatur unterschieden, die unterschiedliche technische Merkmale aufweisen: Die «einfache» elektronische Signatur; die fortgeschrittene elektronische Signatur, die geregelte elektronische Signatur und die qualifizierte elektronische Signatur. Nach Schweizer Recht ist gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR nur die qualifizierte elektronische Signatur, die mit einem qualifizierten elektronischen Zeitstempel versehen ist, einer eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt. Nur diese Form der elektronischen Signatur erfüllt die Formvorschrift der einfachen Schriftlichkeit – wobei abweichende gesetzliche oder vertragliche Regelungen vorbehalten sind.
Wichtig ist: Die qualifizierte elektronische Signatur muss von einem anerkannten Anbieter von Zertifizierungsdiensten ausgestellt werden. Die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) akkreditiert die Anerkennungsstellen, die ihrerseits für die Anerkennung von Anbietern von Zertifizierungsdiensten zuständig sind (vgl. Art. 5 Abs. 1 ZertES). Die derzeit einzige Anerkennungsstelle ist die KPMG AG. Zurzeit gibt es in der Schweiz nur vier anerkannte Anbieter von Zertifizierungsdiensten. Die aktuelle Liste der anerkannten Anbieter kann online abgerufen werden.
Tipp: Bei Unsicherheiten über die Gültigkeit eines elektronisch signierten Dokuments und die Gleichwertigkeit mit einer eigenhändigen Unterschrift kann dies auf einer Website des Bundes überprüft werden: www.validator.admin.ch. Das Tool prüft, ob die elektronische Signatur die Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt.
Fazit elektronische Signatur
Arbeitsverträge, welche die oben erwähnten Bestimmungen enthalten, sowie bestimmte Arten von Arbeitsverträgen bedürfen deshalb entweder der eigenhändigen Unterschrift aller beteiligten Parteien oder einer qualifizierten elektronischen Unterschrift mit einem qualifizierten Zeitstempel, die gesetzlich einer eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist, um rechtsgültig abgeschlossen zu werden. Eine gültige elektronische Unterschrift ist nicht dasselbe wie eine Unterschrift, die mit mechanischen Mitteln, z.B. durch einen Stempel, durch Druck oder durch Faksimile, reproduziert wird. Nicht jede elektronische Unterschrift ist mit der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt.
Es empfiehlt sich, Dokumente mit einer elektronischen Signatur genauer zu prüfen. Damit lässt sich feststellen, ob die elektronische Signatur die Anforderungen erfüllt und das Dokument gültig unterzeichnet wurde.