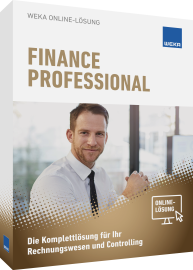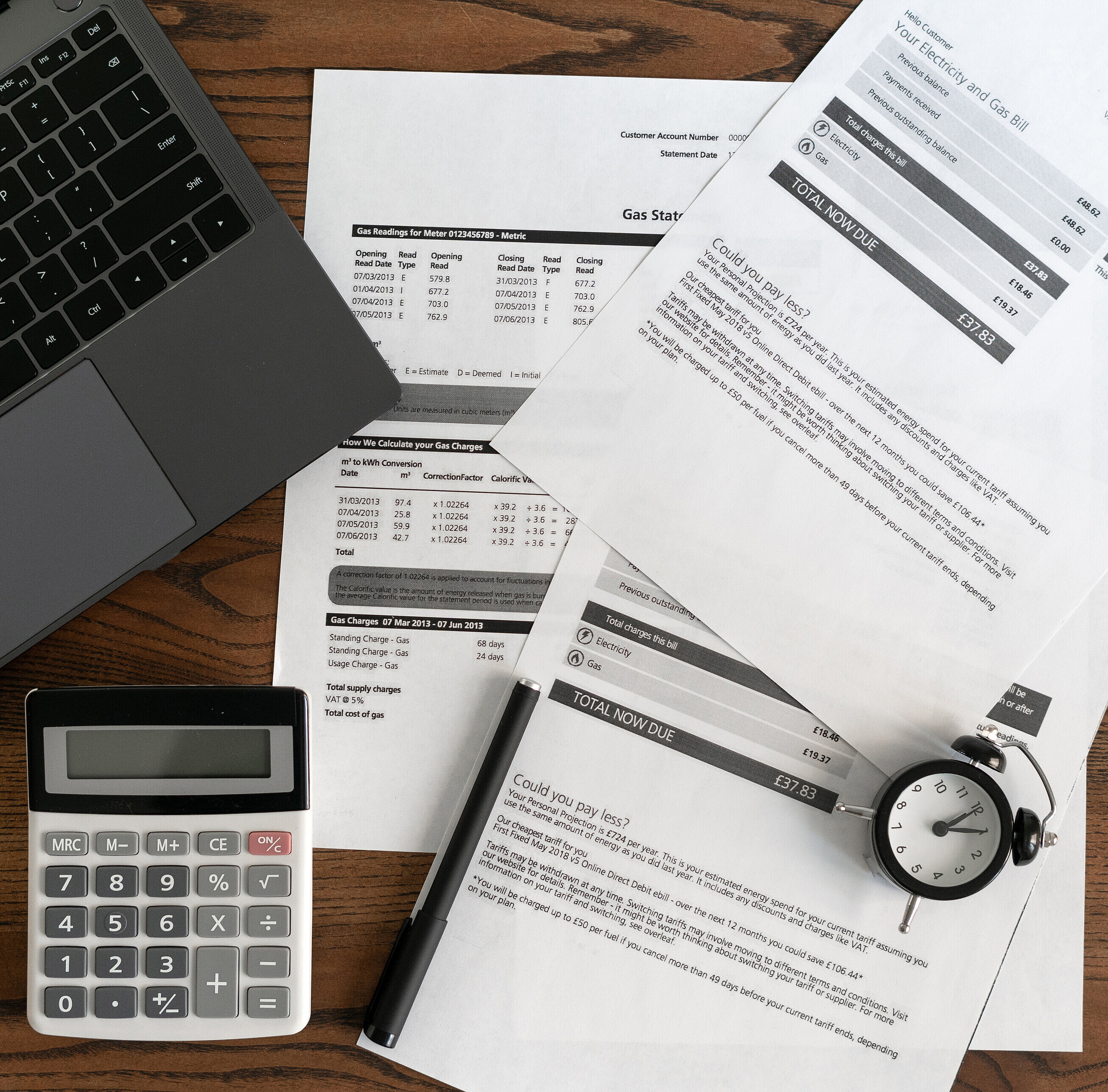Langfristige Aufträge: Das gilt in Bezug zur Rechnungslegung

Passende Arbeitshilfen
Viele Unternehmen mit dem Thema «langfristige Aufträge» stehen vor der Herausforderung, diese am Abschlussstichtag korrekt zu bilanzieren. Vor allem in Abschlüssen nach anerkannten Standards zur Rechnungslegung werden zwei grundsätzliche Methoden für die Bilanzierung und Bewertung unterschieden:
- die Completed-Contract-Methode (CCM) und
- die Percentage-of-Completion-Methode (POC).
Zu den anerkannten Standards der Rechnungslegung in der Schweiz gehören die Swiss GAAP FER, die IAS/IFRS, die IFRS für SMEs sowie mit gewissen Einschränkungen auch die US GAAP. Zwingend anzuwenden ist ein anerkannter Standard zur Rechnungslegung gemäss Art. 962 Abs. 1 OR von
- Gesellschaften, deren Beteiligungspapiere an einer in- oder ausländischen Börse kotiert sind, sofern dies die Börse verlangt,
- Genossenschaften mit mindestens 2000 Genossenschaftern sowie
- Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind (Art. 83 b Abs. 3 ZGB i. V. m. Art. 727 Abs. 1 OR).
Die periodengerechte Zuordnung der erbrachten Fertigungsleistungen und der Umsätze kann je nach der angewendeten Bewertungsmethode zu einer unterschiedlichen Gewinn- und Vermögensdarstellung führen. Weitere für die Bewertung relevante Merkmale könnten z.B. Vertragsart, Gestaltungen, Handhabung der Gruppen-Aufträge, Ermittlung des Fertigstellungsgrads, Verluste aus den Verträgen, Anzahlungen, konzerninterne Preise, Auslastungen etc. sein.
Überblick zu den der Bilanzierungsmethoden für langfristige Aufträge: POC und CCM
Langfristige Aufträge erstrecken sich über mehrere Rechnungsperioden und erfordern eine zeitliche Abgrenzung von Erlösen und Kosten. Für die Bilanzierungspraxis bei langfristigen Aufträgen stehen grundsätzlich die beiden Methoden CCM und POC zur Verfügung, die allerdings ganz unterschiedliche Anforderungen aufweisen.
Die CC-Methode sieht vor, dass nur die aufgelaufenen Kosten (ohne Gewinnzuschlag) in der Bilanz unter der Position Fabrikate bzw. Aufträge in Arbeit innerhalb der Vorräte aktiviert werden.
Die durch die IAS/IFRS sowie die Swiss GAAP FER vorgeschriebene POC-Methode geht zwar vordergründig von denselben Prinzipien wie die CCM aus, sieht jedoch unter bestimmten Voraussetzungen vor, die erwartete Zielmarge (Gewinn) aus dem Auftrag bereits periodengerecht in der Erfolgsrechnung abzubilden. Diese Methode findet insbesondere Anwendung bei langfristigen Aufträgen, bei denen eine präzise und kontinuierliche Abbildung des Projekterfolgs erforderlich ist. Sie erfüllt somit die Forderung nach der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Allerdings ist ihre Anwendung auch an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft, bei deren Nicht-Vorliegen somit anderenfalls die CC-Methode oder auch die modifizierte CC-Methode als Alternative verbleibt. Beide werden im Weiteren noch vorgestellt.
In der Auslegung bedeutet periodengerecht, dass ein Auftrag entweder nach dem geschätzten Fortschrittsgrad (FSG oder auch Output-Methode) oder nach der Kostenverbrauchsmethode (C2C oder Input-Methode) bewertet wird und in diesem Verhältnis die Zielmarge zusätzlich zu den Kosten aktiviert wird und damit in den periodengerecht abgegrenzten Unternehmensgewinn einfliesst. Die Anwendung solcher Methoden erweist sich besonders als entscheidend, wenn es sich um langfristige Aufträge handelt, und um die wirtschaftliche Realität adäquat abzubilden.
Anforderungen und Standards bei langfristigen Fertigungsprojekten
Langfristige Aufträge werden nach IAS 11 bilanziert und dabei wird die POC-Methode bevorzugt angewendet, sofern die im Standard bestimmten Voraussetzungen erfüllt sind. Bei dieser Methode erhält die verlässliche Prüfung der verlustfreien Bewertung allerdings im Vergleich zur CCM eine noch grössere Bedeutung. So muss sichergestellt sein, dass der Fertigstellungsgrad, die Auftragserlöse und -kosten verlässlich geschätzt werden können. Weiter besteht eine vertragliche Grundlage und es muss daher wahrscheinlich sein, dass die Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen werden. Zudem unterscheidet IAS11 zwischen zwei Vertragstypen; den Festpreisverträgen und den Kostenzuschlagsverträgen, für die jeweils unterschiedliche Bedingungen kumulativ erfüllt sein müssen.
Ein periodengerechter Ausweis des Erfolgs ist das Hauptziel der IAS/IFRS sowie von Swiss GAAP FER. Damit orientieren sich diese beiden anerkannten Standards primär am Anlegerschutz bzw. Schutz der Eigenkapitalgeber. Dagegen hat das Vorsichtsprinzip lediglich eine nachrangige Stellung und wird, im Gegensatz zur handelsrechtlichen Bilanzierung gemäss dem Obligationenrecht, von der periodengerechten Erfolgsermittlung dominiert. Daraus folgt, dass Gewinne aus Vermögensgegenständen realisiert werden müssen, wenn verlässlich zu schätzen ist, dass die zukünftigen Erträge eines langfristigen Kundenauftrags grösser sind als die korrespondierenden Aufwendungen. Die Bewertung und Bilanzierung langfristiger Fertigungsaufträge sind zum einen in den IAS 11 sowie zum anderen im Swiss GAAP FER 22 geregelt. Diese Standards bieten einen verbindlichen Rahmen für den korrekten Umgang mit langfristigen Aufträgen, insbesondere bei komplexen Bau- oder Dienstleistungsprojekten.
Demgegenüber dominiert der obligationenrechtliche Abschluss am Gläubigerschutz bzw. am Schutz der Fremdkapitalgeber. Hieraus nährt sich folglich auch die Legitimation für die gesetzlich geforderte Bilanzierung nach dem Vorsichtsprinzip und damit für die gesetzlich erlaubte Bildung stiller Reserven. Letztere führen dazu, dass weniger Gewinn ausgewiesen wird und in der Folge die Gewinnausschüttung an die Anleger tendenziell tiefer ausfallen wird. Dies erhöht das Haftungssubstrat für Gläubiger einer Unternehmung, was vom Gesetzgeber als prioritär erachtet wird.
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare