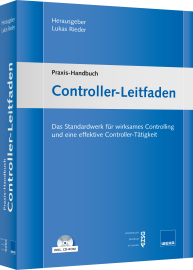Produktionsplanung: So berechnen Sie die Effizienz der Produktion

Passende Arbeitshilfen
Die Leistungsfähigkeit Ihrer Produktionsplanung hängt von zahlreichen Faktoren ab. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Produktionsplanung und die Kapazitätsauslastung. Eine hohe Kapazitätsauslastung ist die Grundlage für einen wirtschaftlich arbeitenden Produktionsprozess und niedrige Stückkosten. Allerdings steht eine hohe Kapazitätsauslastung anderen Zielen entgegen, wie z.B. einer zügigen Auftragsabwicklung, kurzen Lieferzeiten oder einer hohen Termintreue. Dies liegt unter anderem daran, dass es bei ausgelasteten Produktionskapazitäten zu Engpässen kommen kann, wenn Sie Fertigungsaufträge nach hinten verschieben müssen und hierdurch nicht termingerecht liefern können.
Berechnung der Kapazitätsauslastung
Für die Berechnung der Kapazitätsauslastung muss zunächst festgelegt werden, wann die Kapazitäten voll ausgelastet sind. Grundsätzlich wird unter Kapazität das theoretisch mögliche Leistungsvermögen einer Kostenstelle in einer Periode verstanden. Dabei können Sie die Kapazität in Mengeneinheiten (Stück, Meter etc.) oder in Zeiteinheiten (Fertigungsstunden, Maschinenstunden etc.) ausdrücken. Ausgehend von dieser Feststellung können Sie zwischen sehr unterschiedlichen Kapazitätsbegriffen unterscheiden. In Betracht kommen beispielsweise die Maximalkapazität, die Optimalkapazität oder die technisch mögliche Kapazität:
Die Maximalkapazität haben Sie erreicht, wenn alle vorhandenen Kapazitäten einer Kostenstelle zu 100% ausgelastet sind. Hierzu wäre es erforderlich, dass an allen Tagen des Monats in drei Schichten zu jeweils acht Stunden ohne Unterbrechungen, Pausen, Stillstände oder Störungen voll produktiv gearbeitet wird. Es handelt sich bei dieser Kapazität nur um eine theoretische Grösse, die in der betrieblichen Praxis nur in ganz seltenen Fällen zum Einsatz kommt. Sie können die Maximalkapazität aber als Ausgangsgrösse für einen realistischen Beschäftigungsansatz verwenden.
Die Optimalkapazität ist eine rein wirtschaftliche Beschäftigungsgrösse, die auch als kostenbedingtes Optimum bezeichnet wird. Diese Definition stellt auf den Beschäftigungsgrad ab, bei dem die Stückkosten minimiert sind. Bei zunehmender Beschäftigung sinken die Fixkosten pro Leistungseinheit und hierdurch die Stückkosten. Ab einer bestimmten Grenze werden diese Vorteile aber durch das Verhalten sprungfixer oder progressiver Kosten (Überstundenentgelte, Reparaturkosten, Werkzeugkosten, Energiekosten etc.) kompensiert. Letzteres führt dazu, dass die Gesamtstückkosten nicht weiter sinken oder sogar wieder steigen können. Auch bei dieser Definition handelt es sich um einen eher theoretischen Wert, weil er ebenso unrealistisch ist wie die Maximalbeschäftigung.
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare